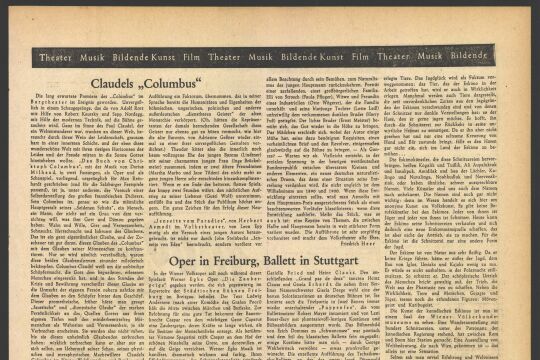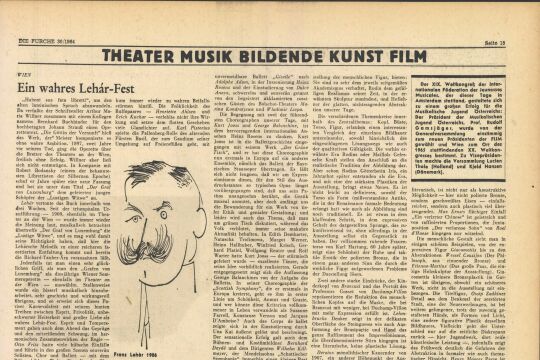Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Huldigung und Abschied
Das letzte abendfüllende Ballett- pnagramm, mit dem Aurel von Milloss von der Wiener Staatsoper Abschied nahm (er wird vor seinem Abgang nach Rom zu dem nächsten Ballettabend nur noch die Choreographie für Strawinskys „Les Noces” beisteuern), war dn mancher Hinsicht eine Huldigung an den Genius loci, der dem in ganz anderen künstlerischen Bezirken heimischen Ballettdirektor in den vergangenen Jahren wohl erst allmählich vertrauter geworden ist. Mit „Coppelia”, „Orpheus verliert Eurydike” und den „Polowetzer Tänzen”, durchweg Werken des 19. Jahrhunderts, hatte Milloss dem hiesigen Publikums- geschmack weitgehende Konzessionen gemacht, ohne dabei auf seine künstlerische Linie zu verzichten, wenngleich diese hier weniger deutlich und überzeugend zum Ausdruck kam als in seinen früheren Programmen.
Millass sah sich ja in Wien von Anfang an vor die Aufgabe gestellt, ein Ballettrepertoire aufzubauen, das die vielfach bestrittene Lebensberechtigung dieser Kunstgattung erst zu beweisen und im Spielplan der Wiener Staatsoper zu verankern hatte. Mit dankenswerter Energie hat er neben der von ihm betriebenen Regeneration und Reorganisation des Ballettkorps in den ersten Jahren mit seinen Ballettabenden der neueren und zeitgenössischen Musik im Spielplan einen Platz erobert, den das . hiesige Opernrepertoire ihr beharrlich vorenthält. Leider ist es ihm nicht gelungen, mit dem Schließen dieser Lücke auch die Stellung des Balletts aus der eines Lückenbüßers herauszuführen und das Interesse des Publikums am Ballett wenigstens so weit zu beleben, daß die Einführung eines „Jour fix” nicht mehr als zu gewagtes Risiko erschienen wäre. Der letzte Ballettalbend wendet sich nun direkt an das Publikum in der gewiß richtigen Erkenntnis, daß das Ballett solange seine höheren künstlerischen Aufgaben schwerlich wird erfüllen können, solange es dem Publikum nicht auch das bietet, was es zu sehen wünscht. Und das ist — man mag es beklagen oder nicht beim Ballett wie bei der Oper ein vorwiegend aus Werken des 19. Jahrhunderts gebildetes Repertoire.
Daß Milloss, auch wo er Konzessionen macht, interessant bleibt und sogar da noch die erzieherische Höherbildung des Publikumsgeschmacks nicht außer acht läßt, macht seinen bevorstehenden Abgang besonders schmerzlich, denn unwillkürlich stellt sich die bange Frage, ob sein Nachfolger willens und imstande sein wird, das erst begonnene Erziehungswerk nicht allein des Balletts, sondern mehr noch des Publikums mit der gebotenen Behutsamkeit, Intelligenz und Umsicht fortzusetzen. Ob er wie Milloss auch die Fähigkeit besitzen wird, dem Populären und scheinbar Altbekannten eine solche Deutung zu geben, in der die Seh- und Dairsitellungsweise des heutigen, Küngtlerts sich zur Geltung bringen läßt.
Milloss hat gerade das in seiner neuen choreographischen Interpretation der „Coppelia” von Delibes versucht. Vielleicht,’ ist ihm das nicht restlos gelungen; vielleicht hat die Zuspitzung der dramatischen Handlung auf die grotesk-tragische Figur de Coppelius; als Romantischen Hexenmeister einer Puppenwelt die im Original von Saint-Leon und Delibes sicherlich gewahrte Einheitlichkeit des Ganzen zerstört. Immerhin aber hat Milloss geistige Bezüge sichtbar gemacht, die das vom Absinken ins bloße Amüsement so stark bedrohte französische Ballett des vorigen Jahrhunderts blitzartig als ein Produkt des Übergangs erhellen, das sich durch seine Verwurzelung im Geist der Romantik E. T. A. Hoffmanns auch einer modemen spekulativen oder tiefenpsychologischen Deutung zugänglich erweist. In der Darstellung war auch die Figur des Coppelius als interessanteste bevorzugt behandelt und bot Peter Kastelik Gelegenheit zu reizvoller tänzerischer Charakterisierung. Erik Zlocha als Swanilda und Paul Vondrak als Franz absolvierten dagegen ihre Solonummern und Pas de Deux mehr oder minder präzis und korrekt und mit jener noch etwas unpersönlichen Anmut, die mehr die Schule lobt als den Schüler. Emanuele Luzzati errichtete auf der Bühne ein hübsches Bilderbuch in Chagall-Manier, das bei all seinen optischen Reizen den Intentionen des Choreographen doch nicht ganz entsprach, der auf der Bühne offenbar mehr die Stimmung und Atmosphäre eines Nachtstückes von E. T. A. Hoffmann (dessen Novelle „Der Sandmann” dem Lihretto zugrunde liegt) vergegenwärtigen wollte.
Tänzerischer Höhepunkt des Abends war zweifellos der in klassischer Form dramatisch ausgebaute Pas de Deux „Orpheus verliert Eurydike” nach Liszts symphonischer Dichtung „Orpheus”, den Christi Zimmerl und Karl Musil tanzten. Auch diese Nummer kann man als eine „Konzession” von Milloss bezeichnen, dessen Liebe vermutlich nicht der von Liszt repräsentierten Romantik gehört und wohl auch nicht dem klassischen Ballett. Beides aber erfuhr durch ihn choreographisch eine so edle und kultivierte Ausgestaltung, daß diese Szene der Wiederbegegnung, des gemeinsamen Weges und der für Eurydike tödlichen Umarmung der beiden Liebenden durch Christi Zimmerl und Karl Musil zu einem Tanzpoem von unvergeßlicher Schönheit wurde.
Die „Polowetzer Tänzer”, als orgiastisches Finale gedacht und von der Choreographie auch als tänzerischer Ausdruck vitaler Wildheit aufgebaut, kam allerdings durch die Kostüme Luzzatis, die die Bewegung mehr verhüllen als unterstreichen, um die gewünschte Wirkung. Exotik und Stiltreue in Ehren — aber Balletteusen in langen Beinkleidern mit züchtig verhüllten Busen und wilde Krieger in Helm und Harnisch können trotz höchster Sprünge nicht jenes Minimum an erotischem Fluidum erzeugen, ohne das selbst bei bescheidensten Ansprüchen eine tänzerische Begegnung der beiden Geschlechter nicht zielführend vorstellbar ist. Ungeachtet dessen war hier die Gesamtleistung des vollständig eingesetzten Ballettkorps beachtlich, und wer sie unter ihrer Vermummung zu identifizieren vermochte, konnte auch an Lisl Maar und Ludwig M. Musil seine Freude haben. Die Freude an der von Wilhelm Loibner dirigierten Orchesterbegleitung hielt sich allerdings in maßvollen Grenzen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!