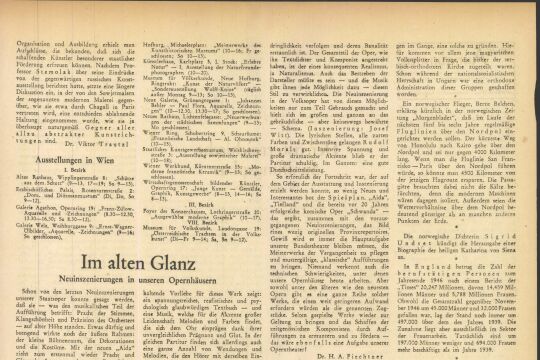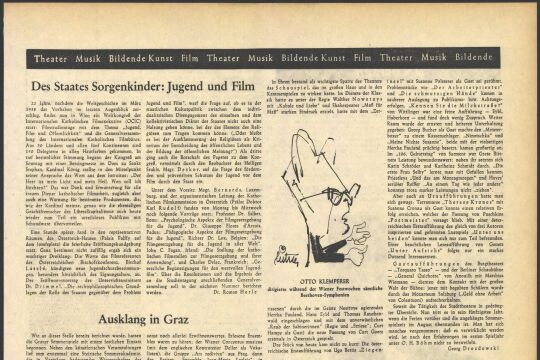Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Eine echte Volksoper
Vor zehn Jahren wurde, zum 100. Geburtstag Wilhelm Kienzls, dessen populärstes Werk, „Der Evangelimann“, an der Wiener Volksoper neu einstudiert. Bereits 1948 stand es auf dem Nachkriegsspielplan, und nun beschert uns die Volksoper eine weitere Neuinszenierung. Ob man dabei an den 110. Geburtstag des Komponisten gedacht hat und einer Ehrenpflicht nachkommen wollte? Oder ob man auf die Popularität eines Werkes baute, das seit seiner Berliner Premiere im Jahr
1895 über rund 150 Bühnen gegangen ist, sich aber freilich nur im deutschen Sprachraum einigermaßen halten konnte?
Kienzl selbst, der ein hochgebildeter Mann und ein scharfsinniger Kritiker war, stellte sich in späteren Jahren die Frage: „Was mag wohl an meinem ,Evangelimann' so schlecht sein, daß er allen gefällt?“ Natürlich vermochte er als Autor nicht die Schwächen seines Hauptwerkes zu sehen, sondern erklärt dessen Erfolg mit dem „rein Menschlichen der Handlung“, die zugleich „nach Musik schreit“, und Josef Jirouschek kennzeichnet in seinem Opernlexikon von 1948 Kienzl als „einen ungemein liebenswürdigen Vertreter echten und schlichten österreichischen Musikan-tentums“. Eduard Hanslick freilich schrieb schon nach der Premiere, es handle sich beim „Evangelimann“ um ein „bürgerliches Rührstück“ und um das Wiederaufleben „des Iff-land-Schröder-Kotzebueschen Jammers“, den man längst entschwunden glaubte. Doch vermochten die kritischen Stimmen dem Stück nicht zu schaden. Im protestantischen Norden wie im katholischen Süden erfreute es sich — vor allem wegen seiner neutestamentlichen Ethik — gleicher Beliebtheit, zumal man wußte, daß die ergreifende Handlung nicht erfunden, sondern mit nur wenigen Änderungen nach einer wahren Begebenheit gestaltet ist, die der Währinger Polizeikommissär Dr. Leopold Florian Meissner aufgezeichnet hat.
Matthias, der passive Held, ist das Opfer einer Verleumdung bzw. eines Justizirrtums und wird, der Brandstiftung angeklagt, für 20 Jahre in den Kerker geworfen, aus dem er (im Herbst 1841) körperlich und geistig gebrochen entlassen wird. Weitere zehn Jahre später (Marthas Pfleger und Onkel, der Justitiar, ist inzwischen gestorben, Martha selbst hat sich in der Donau ertränkt) begegnet er seinem Bruder und Rivalen, dem Lehrer Johannes, der der Urheber seines Unglücks ist, als
einem Sterbenden — und verzeiht ihm.
Edwin Zbonek als Regisseur, Wal. ter Hoesslin als Bühnenbildner und Alice Maria Schlesinger als Kostüm-zeichnerin haben etwas realisiert, für das man ihnen dankbar sein muß: Sie haben das volkstümliche Werk genau so auf die Bühne gebracht, wie es konzipiert wurde und wie es seinem Stil entspricht („Mein Werk ist in der künstlerischen Darstellung realistisch und im Ziel ideal“). Die einfachen, schönen Bilder haben überdies den Vorzug der Authentizität und erinnern in ihrem Gesamteindruck an Waldmüller. Die männlichen Hauptrollen waren mit Rudolf Christ — Amtsschreiber Matthias, Ernst Gutstein — Johannes Freudhofer, Lehrer zu St. Othmar, Friedrich Nidetzky — Justitiar, und Peter Drahosch — Schneider Zitterbart gut, die weiblichen Partien mit Gerlinde Lorenz — Martha, und Milka Nistor (einer jungen Rumänin) — Magdalena sehr gut besetzt.
Die in ihrer Art meisterhafte Partitur mit den registerartigen Orchesterklängen, den ausgedehnten Chor-partien und den dem Wort- und Satzrhythmus sich genau anschmiegenden Gesangspartien wurde von Dietfried Bernet aufmerksam betreut und vom Orchester genau und klangschön wiedergegeben. Im ganzen: Eine echte Volksoper in der ihr adäquaten Inszenierung.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!