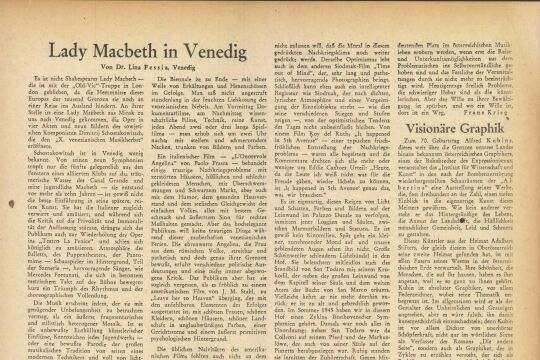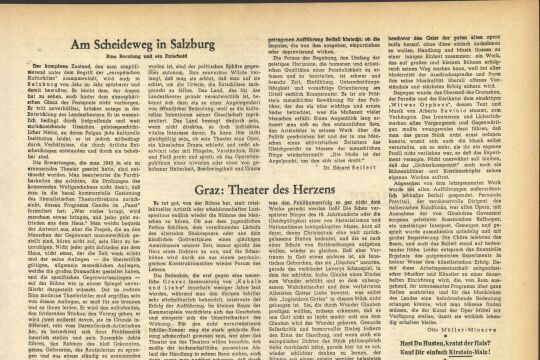Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Goldoni — Sartre — Barlach
Die Städtischen Bühnen Münster, die ihre große Zeit in den zwanziger Jahren hatten, als Niedecken- Gebhardt, Kurt Jooss und Hein Heckroth und andere hier wirkten, als die mün- stersche „Händel-Renaissance” bejubelt wurde, haben seit dem Krieg vornehmlich dttrchj i ihren /Rahmqn vo . sich. : t 4ep,.i gemacht. .Das „Neqe Haus” nämlich, das 1956 an die Stelle .des vom Krieg, zerstörten Theaterbaues trat, geriet ob seiner extravaganten Bauweise bald in den Mittelpunkt heftiger Diskussionen, die weit über Münster hinaus die Gemüter der Fachleute erregten. Ähnlicher Widerhall ist den künstlerischen Leistungen in diesem Haus versagt geblieben; im deutschen Theaterleben zählt Münster, so scheint es, zur Statisterie.
Tatsächlich gehört das westfälische Münster, wo man nicht ohne Stolz darauf verweist, daß man schon längst ein ständiges Theater hatte, als sich etwa im Burgtheater zum erstenmal der Vorhang hob, mit seinen 180.000 Einwohnern zweifellos zur Provinz. Aber das Schlagwort vom „Provinztheater” hat in der Gegenwart eine so eindeutig abwertende Tendenz, daß man es ungern ohne zwingenden Grund auf die dortige Bühne und ihre Leistungen anwenden möchte. Gewiß fehlt dem Theaterleben in Münster der Glanz; gewiß gibt man sich oft, allzuoft mit dem handwerklich Guten, dem Braven und Biederen zufrieden. Aber es hat dort auch Leistungen gegeben, denen vor der attraktiven Kulisse Hamburgs, Berlins oder Münchens, ja auch Düsseldorfs und Frankfurts, größerer Widerhall und weitere Anerkennung zuteil geworden wäre. In Münster hat man sie übersehen — vielleicht, weil man sie dort nicht erwartet hatte...
Allein in dieser Spielzeit, der ersten unter dem neuen Intendanten A. E. S i- s t i g, hat es bisher drei Aufführungen gegeben, die man beim besten oder vielmehr bösesten Willen nicht als „provinziell” bezeichnen möchte. Und die Tatsache, daß drei so verschiedenartige Autoren, wie Goldoni, Sartre und Barlach solcherart überdurchschnittlich interpretiert wurden, entkräftet auch den Verdacht, es habe sich dabei nur um Zufallstreffer oder eine ungute Spezialisierung gehandelt.
Den Auftakt bildete, als Eröffnungspremiere in den immer noch provisorisch in einer Schulaula untergebrachten Kammerspielen, Carlo G o 1 d o n i s „D i e- ner zweier Herren”, der sozusagen „im Alleingang” von einem Mann bewältigt wurde Otto Tausig inszenierte und spielte selbst die Titelrolle in einem komödiantischen Wirbel von Einfällen und Temperament. Als Regisseur zunächst hatte er die (allzu) kleine Bühne geschickt in den Zuschauerraum hineingezogen, er hatte ihre Begrenzungen gesprengt und so den strengen Guckkasteneffekt vermieden, er hatte den Text sorgsam durchgearbeitet und ihn mit Einfällen und Gags üppig garniert, und er ließ vor allem die Vorstellung ohne forciertes Tempo mit quirlendem Temperament ablaufen. Dabei unterlief ihm nicht ein einziges Mal der plumpe Effekt vordergründiger Burleske; die spielerische Eleganz der Stegreifkomödie harmonierte überaus angenehm und überzeugend mit den Anklängen der Charakterkomödie, die Goldoni in seinem Werk zu verwirklichen trachtete.
nid nut isau jusfüb nsnio sib jwtfcw i’L.s-iqgsjnstlfrnE’I asba’
‘ Wenig ‘Später gab es in ditr Kammeri spielen abermals eine eindringliche Leistung: F. K. Wittichs Inszenierung von S art res „Geschlossene Gesellschaft”. Ein karges Bühnenbild Umriß den Schauplatz, Plüsch wurde zum drehenden Symbol, man glaubte das zähe Verrinnen der Minuten fast körperlich zu spüren, obwohl die Regie das billige Hilfsmittel verschleppter Tempi konsequent vermied — genau so übrigens wie die Spekulation auf das Ungewöhnliche der Situation. Jede Nuance wurde da bedacht und geprüft, und das Endergebnis war ein faszinierendes Geflecht von Motiven und Reaktionen. Die überragende darstellerische Leistung dieses Abends lieferte Rena Lie- benow als Ines, die mühsam unterdrückte Leidenschaften hinter berechnender Glätte aufschimmern ließ.
Als Drittes gab es zur Mitte der Spielzeit eine erschütternde Interpretation von Ernst Barlachs „Die Sündflut”, für die (als Gast) Hans Tügel verantwortlich zeichnete. Dieser große und großartige religiöse Disput, in dem das überlieferte Geschehen der Bibel zum Anlaß wird, das Verhältnis des Menschen zu Gott und das Gottes zu den Menschen zu erforschen, in dem Noah demütig den Anweisungen des „Herrn” folgt und der kriegerische Calan nach wilder Auflehnung zuletzt die Gnade eines Gottes spürt, der „nur Glut” ist, kümmert sich wenig um die Gesetze der dramatischen Kunst. Ungefüge auf den ersten Blick, nur grob behauen wie die Bildwerke des genial doppelbegabten Autors stehen die Szenen nebeneinander. Urtümlich kräftig und doch un- gemein biegsam, der feinsten Schattierung fähig ist die Sprache. Breit fließt die Handlung, ehe sie in der größten Katastrophe der Menschheit mündet, die der Titel beschwört.
All das erschwert die szenische Verwirklichung, die sich nicht der Hilfsmittel attraktiver Geschehensfülle und abwechslungsreicher Situationen bedienen kann. Ganz vom Wert und vom Geist her muß eine Irftzenierung der „Sündflut” leben. Hans Tügel hat sich zu diesem Grundsatz konsequent bekannt. Er hat von Carl W. Vogel ein Bühnenbild bauen lassen, das den nachgerade abgedroschenen Effekt der schrägen Ebene sinnvoll nenentdeckt, das mit wenigen kräftigen Akzenten den Schauplatz andeutet, der dann von Licht kuppelartig überwölbt wird. Elektronische Musik (Sustrate — Sala) ersetzt Sphärenklänge und den Donner der Katastrophe Vor diesem Hintergrund wurde die geistige Substanz des Stückes lebendig im Spiel eines disziplinierten Ensembles.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!