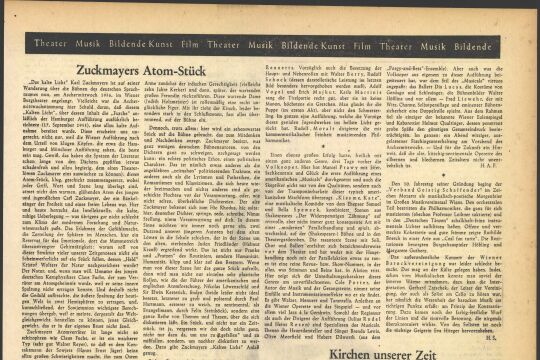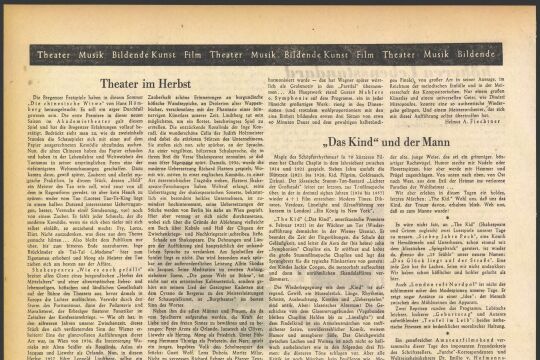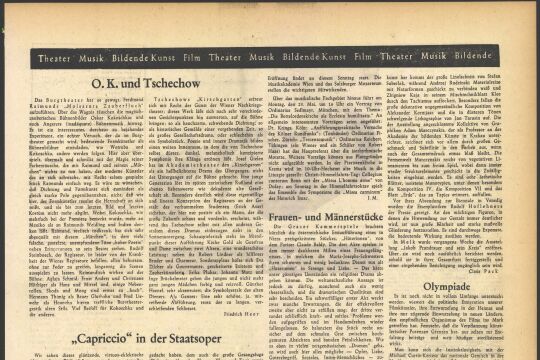Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Nur der Schönheit.
Obwohl die „Liebe der Danae“ erst nach der Capriccio-Uraufführung erklungen ist (1944 in Salzburg, in Form einer Generalprobe), war das Konversationsstück für Musik „Capriccio“, mit dem Libretto von Clemens Krauss, dennoch der eigentliche Abgesang des Musikers Richard Strauss von der Welt der Bühne. München ist diesem Werk in besonderer Weise verbunden, denn im Nationaltheater fand am 28. Oktober ig42_ in Anwesenheit des Komponisten — die Uraufführung statt, inszeniert von Rudolf Hartmann und dirigiert von Clemens Krauss. Auch die Neuinszenierung für die Münchner Festspiele 1970 wurde jetzt von Rudolf Hartmann besorgt, und zweifellos hat er im Cuvillii-Theater den geeigneten Rahmen gefunden, ist doch die Handlung ganz auf Intimität gestimmt (Ita Maximowna schuf einen auf Hochglanz polierten Salon und zauberhafte Kostüme) und völlig aufgelöst in Dialoge, so daß es eine der Hauptaufgaben der Regie ist, für bestmögliche Textverständlichkeit zu sorgen. Rudolf Hartmann hat dieses, von Altersweisheit geprägte Opus, schon in fast allen Kunstmetropolen auf die Bühne gestellt, er beherrscht die spezifische Spielweise der musikalischen Salon-Komödie meisterhaft, jede Bewegung, jeder Blick, jede Aktion löst sich in Musik auf.
Mit seiner Oper „Capriccio“ hat Strauss selbst schon die Antwort auf die Frage gegeben, die in diesem Stück zur Diskussion gestellt wird: Text oder Musik?
Der Komponist „Flamand“ und der Dichter „Olivier“ — beide in die schöne Gräfin verliebt — kämpfen um ihre Vorrechte, und dem Theaterdirektor „La Roche“ ist alles nur Mittel zum Zweck, mit anderen Worten zum theatralischen Effekt. Aber was sie alle vereint, ist die Liebe zur Bühne, und so kann es nur immer wieder zu dieser absonderlichen Kunstform „Oper“ kommen, in der alles integriert ist.
Es soll hier der Anachronismus dieses Werkes nicht verschwiegen sein: Es ist geradezu absurd, in einer Zeit, in der das Barometer faschistischer Vernichtungswut über die Grenzen humanen Denkens und Handelns ausbrach, eine Oper zu schreiben, in der die Problematik ausschließlich in einer anregenden Fachsimpelei zu suchen ist, in einer Zeit, in der sich Schuldlose in Rußland die Glieder vom Leib froren und in den Konzentrationslagern Millionen einem Massensterben entgegensehen mußten, „die Frau Gräfin zu Schokolade
und zum Souper bitten zu lassen“! Aber ein Zwiespalt dieser Art ist in der gesamten Musikgeschichte immer wieder anzutreffen ebenso wie in der bildenden Kunst, und man muß „Capriccio“ als eine letzte Referenz vor der Schönheit sehen, der Schönheit der Musik, des Wortes, des Theaters und — nicht zuletzt, vor der Schönheit einer Frau, die in der „Gräfin“ zur Inkarnation wird.
Schon im Vorspiel, das den Altersstil in gebrochenen Klangfarben spiegelt, begeistert Ferdinand Leitner durch ein äußerst differenziertes, subtiles Musizieren. Er hat in Ciaire Watson eine Gräfin, der man alles glaubt, was über sie gesagt wird, die in dieser Rolle, gesanglich und schauspielerisch, nur als unübertrefflich bezeichnet werden kann. Ihr Charme und ihre Grazie lassen alles erblassen, was sich in diesen Regionen ansiedelt. Aber auch Donald Grobe (Flamand), Barry McDaniel (Olivier), Kieth Engen (La Roche), Charlotte Berthold (Clairon) und Hans Günther Nöcker (Graf) sind vorzüglich, und die „italienischen Sänger“ Ingeborg Hallstein und Anton de Ridder (in Vico-Torreani-Maske) bringen Farbe in das zeremonielle Spiel.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!