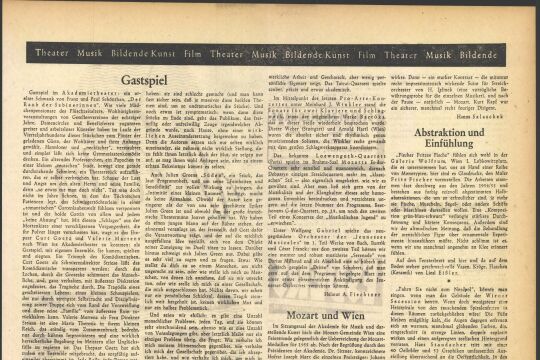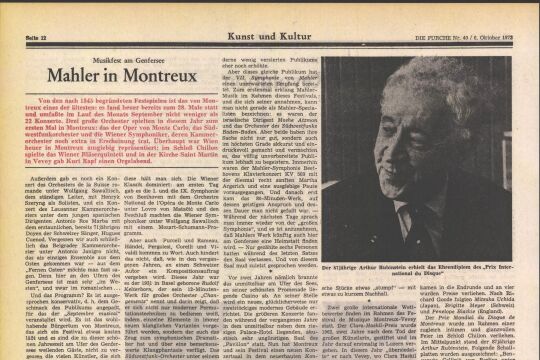Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Berlioz, Berg und Bartok
Das 4. Abonnementkonzert der Wiener Philharmoniker leitete Lorin Maazel. Wir danken ihm die Begegnung mit einem sehr selten gespielten chef d'ceuvre — wenn auch leider nicht mit dem ganzen.
Durch eine Ehrengabe des sonst keineswegs freigebigen Paganini der materiellen Sorgen ledig, konnte sich Hector Berlioz während sieben Monaten des Jahres 1839 ausschließlich der Komposition eines Shakespeare-Werkes widmen, der „dramatischen Symphonie mit Chören“ „Romeo und Julia“. Sie dauert etwa 100 Minuten und übertrifft damit die längste Mahler-Symphonie. Meist hört man nur Bruchstücke daraus, diesmal war die Möglichkeit geboten, einen größeren aus fünf Teilen bestehenden Komplex, freilich ohne Chöre, mit einer Gesamtdauer von 55 Minuten kennenzulernen.
Neben den Opern, symphonischen Dichtungen und Balletten von Gounod, Bellini, Tschaikowsky und Prokofieff, die von dieser ungewöhnlichen Liebesgeschichte fasziniert waren, nimmt das Werk von Berlioz eine besondere Stellung und vielleicht den höchsten Rang ein. Beim Anhören dieser merkwürdigen, von einem kalten Feuer erleuchteten Musik, die zuweilen spröde, dann wieder lyrisch und malerisch, aber nie banal klingt, erinnerten wir uns daran, daß Berlioz der Zeitgenosse der großen Koloristen Ingres und Delacroix war. Aber dieser Erzzau-berer klanglichen Raffinements, dessen „Tratte d'instrumentation“ von 1844 das Standardwerk nicht nur seiner Zeit war, sondern das auch von Vidor, Weingartner und Richard Strauss einer Ergänzung und Fortführung für würdig erachtet wurde, ist trotz allen virtuosen Könnens ein Ausdruckskünstler par excellence, der jedes Instrument „zum Sprechen“ bringt. Als Dramatiker und Symphoniker bildet er mit Liszt und Wagner ein Dreigestirn. Seine Harmonik ist freilich weniger fortschrittlich als die der „Neudeutschen“.
Mit routinierter Leidenschaftlichkeit ist dieser Musik nicht beizukommen. Lorin Maazel bewies, daß er viel von ihrer Eigenart versteht und daß er Berlioz liebt. Die von den Philharmonikern mit lobenswerter Einfühlung und großer Tonschönheit vorgetragenen Teile hießen: 1. Introduktion, Kämpfe (zwischen den Ca-pulets und den Montagues), 2. Romeo allein — Großes Fest bei Capulet, 3. Liebesszene, 4. Königin Mab oder Die Fee der Träume (ein von Berlioz frei erfundenes Scherzo-Intermezzo, 5. Romeo in der Gruft der Capulets.
Wie wenig beliebt Berlioz, dieser „Unbekannte von der Seine“, bei uns ist, bezeugte der sehr zurückhaltende Applaus. Alle schienen auf das den zweiten Teil des Programms bildende „Heldenleben“ von Richard Strauss zu warten. (Das besprochene Konzert ist am 24. Dezember um 20 Uhr über ö 1 zu hören. Aber wer wird da Zeit haben?)
Alban Bergs „Sieben frühe Lieder“ auf romantische Texte von Carl Hauptmann, Lenau, Storm, Rilke,
Johannes Schlaf, Hartleben und Paul Hohenberg sind in den Jahren 1905 bis 1908 unter der Aufsicht seines Lehrers Arnold Schönberg entstanden (sie erschienen erst 1928 in Druck, zugleich mit der Orchesterfassung). In ihnen zeigt sich der spätere Meister konzentrierter Ausdrucksmusik ebenso wie der künftige Musikdramatiker. Am erstaunlichsten aber ist die Führung der Singstimme. Mechtild Gessendorf war die Solistin in einem Konzert der „Jeunesses“ im Großen Konzerthaussaal. Die aus Bayern stammende Sängerin haben wir vor Jahren in der Wiener Kammeroper gehört, sie war mehrere Male in schwierigsten modernen Partien eingesprungen und ist jetzt in Bonn tätig. Ihr heller, nie schrill klingender Sopran besitzt ein Timbre von seltener Schönheit, in der mittleren und in der oberen Lage ist die Stimme auch stark genug, aber von F 1 abwärts war sie fast unhörbar, zumal Milan Horvat das ORF-Orchester zahlreiche piano- und pianis-simo-Stellen mezzoforte spielen ließ.
Im Auftrag der ungarischen Regierung schrieb Bela Bartok zum 50. Jahrestag der Vereinigung von Buda und Pest eine sechsteilige, knapp 30 Minuten dauernde Tanzsuite, die am 19. November 1923 uraufgeführt wurde. Dem Anlaß entsprechend, basiert diese Komposition auf ungarischer Folklore, aber nicht, indem Zitat an Zitat gereiht wird, sondern durch den Charakter der Musik: die Melodik ist von Pentatonik und Kirchentonarten bestimmt, wodurch eine fast vollständige Emanzipation von der westlichen Dur-Moll-Tonalität erfolgt, ebenso unterscheidet sich die unregelmäßige Rhythmik von der traditionellen klassischen und romantischen. — Die Qualität dieses Werkes wurde sofort erkannt, und im Laufe eines Jahres nach der Uraufführung wurde die „Tanzsuite“ allein in Deutschland mehr als 50mal gespielt (Ja, das gab es damals!). Das heikle Werk hätte noch eine oder zwei Proben gut vertragen. Im halbleeren Saal war die klangliche Wirkung sehr reduziert. — Den 2. Teil des Programms bildeten Mussorgskys „Bilder einer Ausstellung“ in der Instrumentation Ravels. (Das Konzert ist am Samstag, dem 16. Dezember um 17.10 Uhr im Programm ö 1 zu hören.)
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!