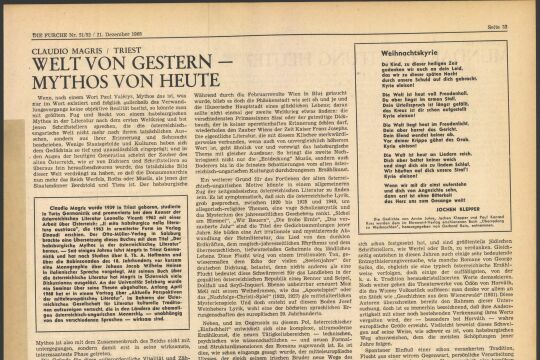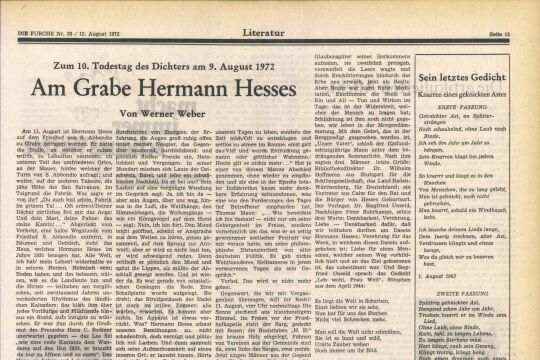Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Hermann Lenz und sein Wahlthema Österreich
Er schreibt seine Bücher mit einer Eintauchfeder, an einem Schreibtisch, an dem er schon seine Schulaufgaben gemacht hat, der 66jährige Württemberger Hermann Lenz, der vor kurzem in Wien aus seinen Werken las. Diese Werke des 1978 mit dem Büchner-Preis Ausgezeichneten und von der Kritik als „letzter Non- Konformist“ Charakterisierten gehören heute schon zum Dissertationsthema junger österreichischer Germanistikstudenten. Und das mit Recht, denn Österreich und das Wien der endenden Monarchie sind das Wahlthema dieses heute in München lebenden Schriftstellers, dessen Talent schon Thomas Mann erkannt hatte und dessen autobiographische Romane Peter Handke einen „poetischen Geschichtsunterricht“ nannte.
So wie alte Maler in einer Ecke ihrer Bilder sich selbst abbildeten, so stellt Hermann Lenz in seinen Romanen und Erzählungen immer wieder eine Beziehung zwischen den Hauptpersonen und Franz Joseph I, her, der, wenn auch nur in einer „Nebenrolle“, doch im Fluchtpunkt der gewählten Perspektive auftaucht.
Die „Augen eines Dieners“ lenken den Blick auf eine 1910 im Schloß Schoeneben bei Wien beginnende Handlung. In diesem Jahr beginnt
auch der Roman „Der Kutscher und der Wappenmaler“, und die Erzählung „Dame und Scharfrichter“ endet mit einem Blick des Kaisers auf ein Kalenderblatt mit der Zahl 1903.
Sein jüngstes Werk „Die Begegnung“, dieses Triptychon mit den schmalen schwäbischen Seitenflügeln und dem breiten österreichischen Mittelstück, wie es Albert von Schirnding nannte, wählt, beginnend mit dem Revolutionsjahr 1848, Wien als Hauptschauplatz.
Schon in seiner Jugend begann Hermann Lenz mit Hilfe eines Stadtplans aus einem alten Lexikon in seiner Phantasie in Wien zu leben. Als er sich dann vom Nationalsozialismus abgestoßen fühlte und dennoch als Soldat in den Zweiten Weltkrieg hineingezerrt wurde, nahm das alte Österreich wohl für ihn den Charakter einer rückwärtsgewandten Utopie an.
Aber das geschah nicht nur aus „Escapismus, also aus dem Bedürfnis einer empfindlichen Natur, sich von der eigenen Epoche ab- und einer durch Tod gereinigten Sphäre zuzu
wenden“, wie er früher einmal selbst über sich urteilte. Spätestens mit den drei, 1962 unter dem Titel „Spiegelhütte“ erschienenen, allegorischen Erzählungen bewies Hermann Lenz, daß er auch in die Zukunft zu sehen vermag.
Sechs Jahre vor der Studentenrevolte erkannte er, daß der „Zeitstil.., eine gewisse Aufsässigkeit“ erfordert, sah er Prestigekonsum und Umweltverseuchung voraus und schilderte er mit der „Coito, ergo
Frage „Haben oder Sein?“ hat er für sich schon längst entschieden. Verzicht ist für ihn, wie er in der Diskussion nach seiner Wiener Lesung sagte, ein wichtiges Wort. Und er meint damit nicht nur, daß er es in seinem Leben nur bis zum Fahrrad gebracht hat und die Sättigungsgrenze des Fernsehens während seines Urlaubs im bayrischen Wald erreicht.
Natürlich müssen wir uns mit Camus davor hüten, nur von außen her wahrnehmbaren Existenzen eine
sum“-Parole anschaulich die Auswüchse einer permissiven Gesellschaft des „Babylonismus“.
Dabei sah er aber auch schon um die Ecke dieser zu unserer Gegenwart gewordenen Zukunft mit ihren nostalgischen Zügen. Immer aber blieb er, wie Peter Demetz schrieb, eine „unbeirrbare Gegenstimme“, die freilich erst heute „nicht länger zu überhören“ ist, weil sie schon früher den Mut hatte, der „propagierten Zügellosigkeit“ einen Lebensstil entgegenzusetzen, der das „Rüde und Vulgäre“ wieder so „verachtet, wie es sich gehört“.
Was Hermann Lenz zur exemplarischen Existenz macht, ist die so seltene Deckungsgleichheit zwischen Werk und Leben. Die für viele erst durch Erich Fromm aktualisierte
„Folgerichtigkeit“ und „Einheitlichkeit“ anzudichten, die „sie in Wirklichkeit nicht haben können“. Immerhin aber hat Hermann Lenz sein eigenes Leben mit seiner autobiographischen Tetralogie von der frühesten Kindheit bis zu den ersten Jahren seines Existenzkampfes als freiberuflich tätiger Schriftsteller nicht nur für sich selbst durchschaubar gemacht.
Er ist kein Agitator seiner selbst, der seine Art zu leben und zu schreiben verbreiten möchte. Er, der so leise spricht und den letzten Satz gern wie eine Frage im Raum stehen läßt, räumt ein, daß er auch unrecht haben könnte. Aber dabei verliert er im Windkanal der Modeströmungen nichts von seiner Kontur und seiner Standfestigkeit, weil seine Wurzeln durch das 19. Jahrhundert hindurch noch tiefer in die Vergangenheit, bis in die Zeit des von ihm irpmer wieder zitierten Marc Aurel reichen.
„Wer stehenbleibt, rückt weit vor in der Zeit“, dieses der „Spiegelhütte“ vorangestellte Motto erklärt, warum
der „geborene .ältere Mann' “ Hermann Lenz erst im Kommen ist.
„Als Autor mußt du an den Fortschritt glauben, und das tu ich nicht“, sagt der Ich-Erzähler in der „Begegnung“ und antwortet auf die Frage „Und woran glaubst du?“: „ Daß alles gar nichts nützte, wenn ich nicht zu mir selbst fand.“ Das ist auch eine Botschaft für jüngere Leser. Denn wenn Hermann Lenz augenzwinkernd auf die Aktualität des Vergangenen anspielt, belehrt er sie und uns auch über die Vergänglichkeit des Aktuellen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!