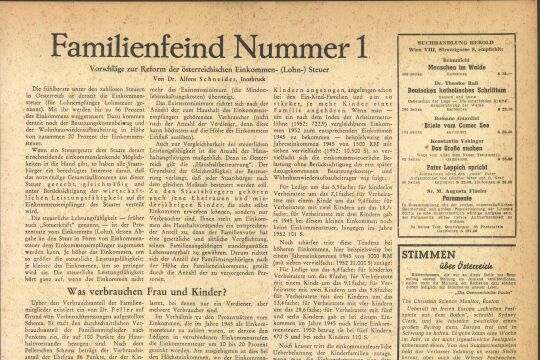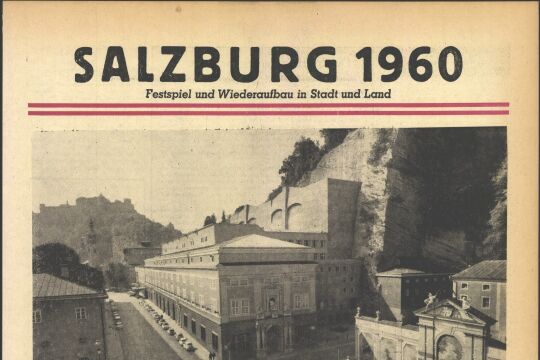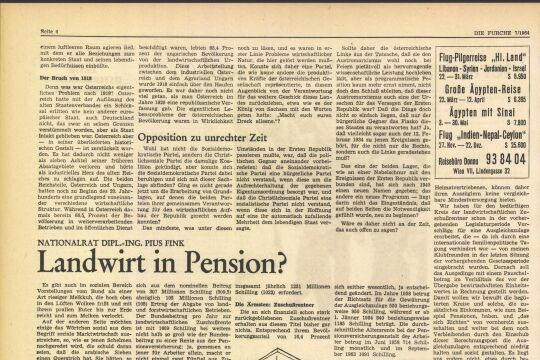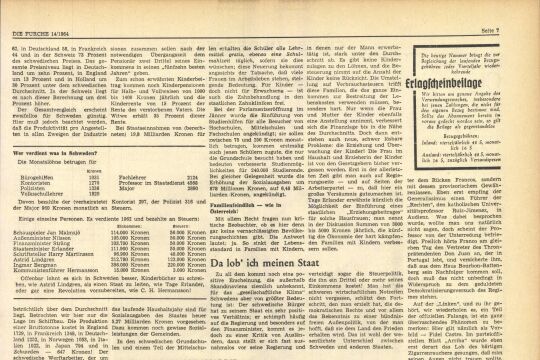Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Kinderreich — dann arm
Wer ist nicht für die Familie? Politische Sonntagsreden feiern sie als Säule der Gesellschaft. Wie es aber materiell um sie steht, deckte kürzlich die Statistik auf.
Wer ist nicht für die Familie? Politische Sonntagsreden feiern sie als Säule der Gesellschaft. Wie es aber materiell um sie steht, deckte kürzlich die Statistik auf.
Daß Wirtschaft und materieller Wohlstand hierzulande zu wachsen haben, ist Teil unseres Selbstverständnisses. Seit den fünfziger Jahren sind wir mit jährlichen Zuwachsraten verwöhnt worden. Selbst in der wirtschaftlich wohl schwierigsten Zeit seit dem Weltkrieg, in den Jahren seit 1975, ist Österreichs Nationalprodukt um 30 Prozent real gewachsen.
Dieser „Segen“ kommt nicht allen gleichermaßen zugute. Kein Wunder. Absolute Verteilungsgerechtigkeit ist nun einmal nicht zu verwirklichen.
Immerhin definiert aber der Staat so etwas wie ein notwendiges Einkommensminimum, indem er Pensionsbeziehern, die weniger als 4.868 Schilling (1987) bekommen, eine Ausgleichszulage gewährt. Damit wird die Untergrenze für das Einkommen eines Ein-Personen-Haushalts markiert.
Ende 1987 gab es nun eine Mi-krozensus-Erhebung, die Aufschluß über das Haushaltseinkommen der Österreicher geben sollte: Männer beziehen im monatlichen Durchschnitt ein (auf 40 Wochenstunden standardisiertes) Einkommen von 10.770 Schilling und Frauen einen entsprechenden Betrag von 8.790 Schilling. Erwartungsgemäß differiert das Einkommen nach dem Bildungsstand: 9.450 Schilling bei Pflichtschulabsolventen gegenüber 14.580 bei Akademikern. .
Das sind beachtliche Differenzen. Noch augenscheinlicher aber ist das Einkommensgefälle, wenn man die Haushaltsgröße als Unterscheidungsmerkmal heranzieht. Uber welchen Betrag verfügen die österreichischen Familien pro Kopf ihrer Mitglieder?
Klarerweise kann man diese Größe nicht einfach dadurch errechnen, daß man Einkommen durch Zahl der Köpfe dividiert: Zwei Alleinlebende haben einen größeren Aufwand als ein Ehepaar, das im selben Haushalt lebt. Und der Aufwand für Kinder nimmt mit deren Alter zu. Um also auf halbwegs vergleichbare Größen zu kommen, muß man die Personen „gewichten“:
Der erste Erwachsene zählt ganz, sein „Gewicht“ ist also eins.
Jeder weitere Erwachsene geht mit dem Faktor 0,7 und Kinder nach dem Alter gestaffelt (von null bis drei Jahren 0,33, dann kontinuierlich steigend bis 0,8 für die 19- bis 21jährigen) in die Berechnung ein.
Das Pro-Kopf-Einkommen eines Paares mit einem ein- und einem 19jährigen Kind ergibt sich somit aus der Division des Haushaltseinkommens durch die Zahl 2,83 (1+0,7+0,33+0,8).
Und nun zu den Ergebnissen der Erhebung: Unter die Armutsgrenze von 4.900 Schilling pro Kopf fallen in Österreich zehn Prozent der Haushalte. Sie rekrutieren sich überwiegend aus Alleinverdienern mit Kindern: Bei den alleinverdienenden Arbeitern mit zwei Kindern sind es 40 Prozent, mit drei Kindern 61 und mit vier sogar 80 Prozent! Die entsprechenden Zahlen bei den Angestellten sind zehn, 15 und 69, bei den Beamten 30,47 und 56 Prozent.
Das heißt: Jeder dritte Arbeiter- und Beamtenhaushalt sinkt einkommensmäßig unter die Armutsgrenze, wenn er sich den Luxus von zwei Kindern und einer nicht mitverdienenden Hausfrau leistet!
Beachtlich ist hingegen der Wohlstand kinderloser Doppelverdiener: Mehr als 14.620 Schilling pro Kopf verdienen rund 35 Prozent der entsprechenden Angestelltenpaare. Bei den Beamten ist der entsprechende Wert 24 und bei den Arbeitern 15 Prozent.
Wie dringend notwendig erweist sich unter diesen Umständen die Erhöhung und die Staffelung der Kinderbeihilfen! Das ist zunächst schlicht und einfach eine Frage der Gerechtigkeit. Sollen wirklich jene, die für das Heranwachsen der nächsten Generation sorgen, dies mit einer derart beachtlichen materiellen Schlechterstellung bezahlen?
Kinder zu haben, ist sicher primär eine große persönliche Bereicherung und sollte vor allem unter diesem Blickwinkel gesehen werden. Es ist aber auch eine Investition in die Zukunft eines Landes, die allen zugute kommt.
Eine Gesellschaft, die sonst jede materielle Investition honoriert, indem sie sie steuerlich begünstigt, sollte diese viel wichtigere menschliche Investition endlich angemessen unterstützen.
Da genügt es nicht, daß uns die Familienministerin auf die Jahre 1991 oder 1992 vertröstet. Kann man sich so einfach damit abfinden, daß der Familienlastenaus-gleichsfonds zwar höhere Abgeltungen für Schulfahrten an, die Verkehrsbetriebe, nicht aber erhöhte Kinderbeihilfen ausschüttet?
Höhere Kinderbeihilfen wären auch ein überfälliges „Ja zum Kind“ in einer kinderarmen Zeit: In den letzten 20 Jahren hat sich unsere Geburtenrate fast halbiert. Heute bringen vier Frauen im gebärfähigen Alter im Durchschnitt nur mehr drei Mädchen zur Welt. Das bedeutet langfristig massiven Bevölkerungsrückgang und enorme soziale Probleme.
Sicher, staatliche Förderung produziert nicht automatisch einen Babyboom, und Bevölkerungspolitik um des wirtschaftlichen Nutzens willen ist eine fragwürdige Angelegenheit.
Dennoch ist es höchste Zeit, endlich den Lippenbekenntnissen für die Familie auch Taten folgen zu lassen. Sollten uns nicht die Fa-milienstrukturdaten zu denken geben? 1971 hatten noch elf Prozent der Familien drei oder mehr Kinder unter 15 Jahren. 1987 war dieser Anteil auf ganze vier(!) Prozent zurückgegangen. Stark steigend war hingegen im selben Zeitraum der Anteil der Familien, die keine Kinder unter 15 hatten: 61 Prozent statt vorher 51.
Kommt da nicht der Verdacht hoch, daß sich Familienförderung politisch nicht auszahlt?
Immerhin: Einige Bundesländer haben aus eigenen Mitteln mit der Familienförderung begonnen. Jetzt ist der Bund an der Reihe, durch materielle Zeichen Mut zum Kind zu machen. Immerhin geben zwei von drei Österreichern an, ihrer Ansicht nach brauche man Familie, um glücklich zu sein.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!