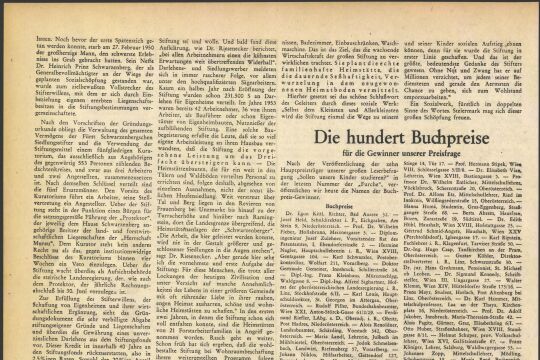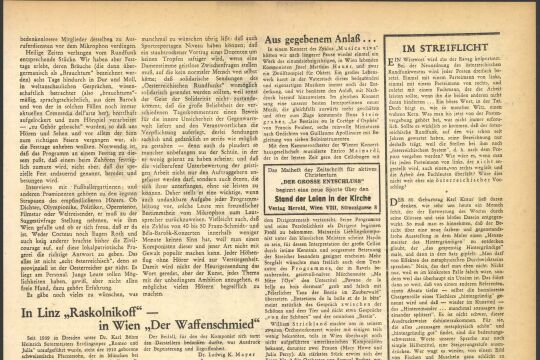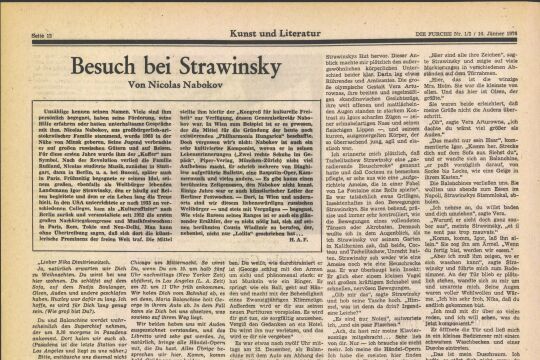Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Musical-Philosophie
Zunächst das äußere Bild. Die Halle D, auf 1600 Plätze reduziert, ist in eine Arena umfunktioniert. In diesem Zirkus in der Wiener Stadthalle sitzt das Publikum, auf Bänken natürlich, nur auf den unteren Rängen, und auf Stockerln dort, wo sich sonst die Reiterinnen und die Clowns tummeln. Wo normalerweise sich die Zuschauer massieren, gibt es „Spielflächen“ (ob es, wie angegeben, 10 sind, konnte ich nicht überblicken). Auf drei Podien, in halber Arena-Höhe, ist auch das Orchester verteilt, insgesamt 16 # Mann, dessen stets durchsichtiger und dezenter Klang durch ein Cembalo und viel Flötenmusik etwas Rokokoartiges erhält. Ursprünglich war es viel größer ...
Zunächst das äußere Bild. Die Halle D, auf 1600 Plätze reduziert, ist in eine Arena umfunktioniert. In diesem Zirkus in der Wiener Stadthalle sitzt das Publikum, auf Bänken natürlich, nur auf den unteren Rängen, und auf Stockerln dort, wo sich sonst die Reiterinnen und die Clowns tummeln. Wo normalerweise sich die Zuschauer massieren, gibt es „Spielflächen“ (ob es, wie angegeben, 10 sind, konnte ich nicht überblicken). Auf drei Podien, in halber Arena-Höhe, ist auch das Orchester verteilt, insgesamt 16 # Mann, dessen stets durchsichtiger und dezenter Klang durch ein Cembalo und viel Flötenmusik etwas Rokokoartiges erhält. Ursprünglich war es viel größer ...
Und damit sind wir an einem wichtigen Punkt angelangt: bei der Geschichte dieses Musicals. 1956 ist es nämllich am Broadway durchgefallen, so wie vor kurzem Leonard Bernsteins jüngstes Bühnenwerk „1600 Pennsylvania Avenue“, das er zur 200-Jahr-Feier der USA geschrieben hat. Erst 1973, in einer Neuproduktion durch Harold Prince und mit reduziertem Orchester, hatte „Candide“ in Amerika Erfolg. Aber ob es sich auch bei uns, in Wien und andernorts in Europa, durchsetzen wird? Die kurze, witzige, zuweilen ein wenig an Strawinsky anklingende Ouvertüre haben wir wiederholt gehört. Aber ansonsten — sie ist ohne Zweifel das beste Stück der ganzen Partitur — findet sich keine einzige Nummer, die „einschlägt“, weder durch ihre Melodie noch ihren Drive. Und immerhin ' dauert „Candide“, in der bei uns gezeigten Fassung, die der von Harold Prince nachgebildet ist, pausenlos durchgespielt volle zwei Stunden ... ,
Die Musik also wird diesen „Candide“ nicht retten, zumal man sich vom Komponisten der „West (Side Story“, ein Jahr später entstanden, und der „Mass“ von 1971 mehr erwartet. Natürlich kann Bernstein sein Handwerk, was man vor allem darin erkennt, Wie er f.ür Singstimmen, vor allem für Koloratursopran, zu schreiben versteht (Hier hat ihn zwar die Königin der Nacht ein wenig inspiriert, aber was tut's). Also muß man sich ans Optische, an die turbulente Handlung und die Interpretation der 19 Musiknummem durch die sechs Hauptdarsteller und die je elf Damen und Herren in Nebenpartien (die Komparserie) halten, die munter und diszipliniert singen, agieren, aber — leider wenig — tanzen. Fast jeder der Darsteller spielt zwei bis vier Rollen. Nur Heinz Ehrenfreund als Candide wird von seinem Schicksal voll beschäftigt, ebenso Melanie Holliday als Kunigunde, gleichermaßen hübsch, lebhaft spielend und virtuos singend; das gilt auch für Christina Simon als Paquette und Blanche Aubry als Old Lady, während es Peter Lindner als Bruder der schönen Kunigunde etwas leichter hat. — Hingegen muß Heinz Marecek gleich fünf die Handlung lenkende Partien absolvieren: als Voltaire, Dr. Pangloss, als Gouverneur, Gastgeber und Weiser, Mann.
Was die vier jungen Menschen Kunigunde und Maximilian, die schönen Kinder eines westfälischen Schloßibesitzers, der uneheliche Sohn einer Schwester des Barons, Candide, sowie das allzeit gefällige Dienstmädchen Paquette alles erleben — damit könnte man ein halbes Dutzend ' Abenteuergeschichten oder Theaterstücke füllen. Ebenso bewegt ist auch ihr Lebenslauf, ihr Stolpern von einer schwierigen Situation in die andere, der häufige, meist unfreiwillige Ortswechsel: Vom besten aller Schlösser, Thunder-Ten-Ti-onck in Westfalen, das ausgerechnet von der bulgarischen Armee erobert und geplündert wird, kommen die jugendlichen Helden und ihr Lehrmeister Pangloss in zweifelhafte Lokale in verschiedenen Gegenden, finden sich unter unerfreulichsten Umständen in Lissabon wieder, geraten nach Montevideo und landen schließlich — in Konstantinopel. Das alles ist bei Voltaire nachzulesen, einer Abenteuergeschichte von etwa 150 Druckseiten mit dem Titel „Candide oder der Optimismus“.
Und damit sind wir am „kritischen Punkt“ dieses „Musicals“ und unse- ' rer Besprechung angelangt. Voltoire schrieb diesen berühmten und berüchtigten „Roman“ 1758 in Schwetzingen und ließ ihn im Jahr darauf in Genf anonym erscheinen. Die Raubdrucke wurden in Frankreich verboten, das Original vom Rat von Genf verdammt und öffentlich verbrannt. Denn es ging Voltaire, dem einflußreichsten „Aufklärer“, nicht nur um die Widerlegung der These Leibniz' von der prästabilierten Harmonie und der .besten aller Welten“, um den Beweis, daß Glaube, Optimismus, Heroismus jeder Art, ja die ganze Metaphysik Unsinn seien, sondern auch um einen gehässigen Angriff gegen die Kirche. Stammt doch „Candide“ aus jener Zeit, als Voltaire die Parole „Ecrasez l'infame“ lancierte, wobei er unter der „Infamen“ die Kirche mit allen ihren Institutionen verstand. Der bekannte und kompetente Romanist Hugo Friedrich bestätigt Voltaire die Gabe, „alles Schwere und Schwierige des gegnerischen wie des eigenen Denkens in ein Spiel zu verwandeln, und sei es selbst in ein teuflisches“.
Alle diese Elemente werden in der besprochenen Aufführung breit und genüßlich ausgespielt, am abstoßendsten im 8. Bild, das in Lissabon unmittelbar nach dem großen Erdbeben spielt und von dem Refrain des „Volkes beherrscht wird: „In der Näh, in der Näh gibt's eine Autodafe!“. Hier in Lissabon teilen sich, laut Voltaire, der Großinquisitor und „ein alter reicher Jude“ in die Gunst der schon recht strapazierten Kunigunde. In der Aufführung in der Stadthalle ist der Nebenbuhler des Großinquisitors der Kanibalenkönig Ngtonga. Der Großinquisitor erscheint edelsteingeschmückt und mit tänzerischen Bewegungen. Hängen, Auspeitschen, Verbrennen: das alles läßt man sich nicht entgehen, und während aller dieser Greuel wird ein etwa zwei Meter großes Holzkreuz durch den Raum geschleppt.
Das verdirbt einem gründlich die Freuide an den vorzüglichen Leistungen aller Mitwirkenden, an die manchmal fast schon lebensgefährliche akrobatische Aufgaben gestellt werden. Viele Köche haben an diesem Brei mitgemischt: Hugh Whee-ler als Spielfouebautor, Richard Wil-bur, Stephen Sondheim und John la Touche als Liedertexter, Marcel Prawy hat das Ganze ins Deutsche übertragen, Larry Füller führte Regie und Adrian Manz leitete sicher und umsichtig das auf drei Podien verteilte Orchester, gab den Solisten ihre Einsätze und sorgte für einen glatten musikalischen Ablauf, Die Frage: „Wozu das Ganze?“ ist um so berechtigter, als Leonard Bernstein offenbar keine rechte Freude mehr an dem Werk hat und in einem Interview sagte, man möge damit machen, was man wolle. — In der Stadthalle will man es einen ganzen Monat lang spielen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!