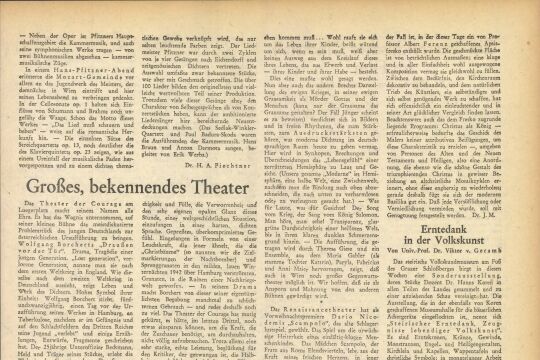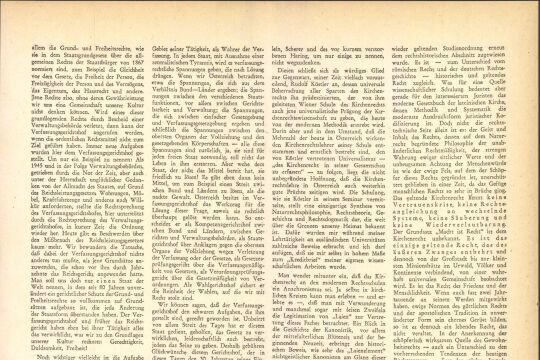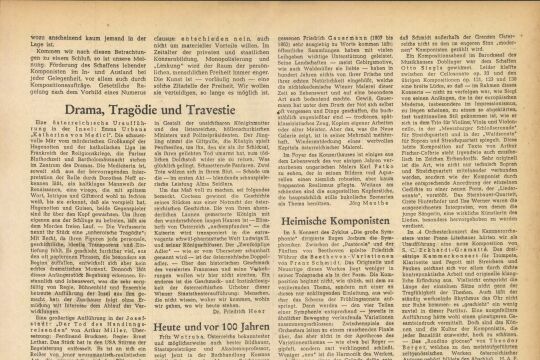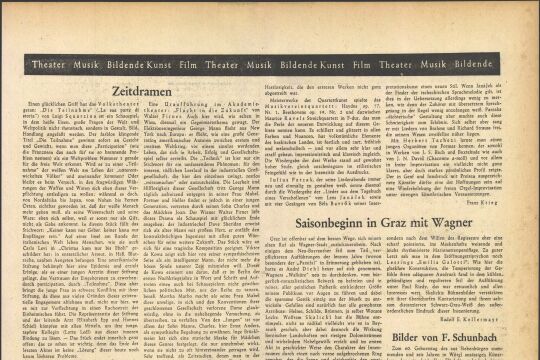Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Stationen des Lebens
Musset glaubte an das Nichts. Mallarme sprach von der Selbstaufhebung im Absoluten des Nichts. Gibt es das Nichts, das restlose Auslöschen im Nichts? Diese Fragen regt der abendfüllende Einakter „Endspiel“ von Samuel Beckett an, der derzeit im Akademietheater aufgeführt wird. Jetzt erst, achtzehn Jahre nachdem dieses wesentliche Stück an einer Wiener Kleinbühne, dem „Theater am Fleischmarkt“, gespielt wurde.
Musset glaubte an das Nichts. Mallarme sprach von der Selbstaufhebung im Absoluten des Nichts. Gibt es das Nichts, das restlose Auslöschen im Nichts? Diese Fragen regt der abendfüllende Einakter „Endspiel“ von Samuel Beckett an, der derzeit im Akademietheater aufgeführt wird. Jetzt erst, achtzehn Jahre nachdem dieses wesentliche Stück an einer Wiener Kleinbühne, dem „Theater am Fleischmarkt“, gespielt wurde.
Der blinde und gelahmte Hamm, sein ihm versklavter Diener Clov, der stehen und liegen, aber nicht sitzen kann, und die Eltern Hamms, geistig verkümmerte, beinlose Krüppel in Mülltonnen, sie alle vegetieren in einem engen Turm, der auf der einen Seite vom Meer, auf der anderen von einer Wüste umgeben ist. Clov blickt durch die Fenstsrlu-ken: „Nichts'—wieder nicnts —^aücfi nichts.“ Und Hamm sagt: „Ich bin nie gewesen.“ In ihm steckt das Nichts, so kann er gar nicht anders, als behaupten: „Gott existiert nicht.“
Dieses grausige Sinnbild von nahezu genialer Penetranz zeigt die letzte furchtbare Konsequenz des selbstentfremdeten, entinnerlichten Menschen von heute. Es entstand im Gefolge des Zweiten Weltkriegs, der Millionen Toten, der zerstörten Städte. Die Wirkung des Stücks war für geistig Sensible gewaltig. Es hat bleibende Bedeutung, da es eine stets mögliche verhängnisvolle innere Position des Menschen fixiert. Nihilismus? Es gibt gerade nur hingetupfte gegenteilige Andeutungen, so wenn Clov schließlich durch die Fensterluke einen kleinen Jungen beobachtet Er ist eine Negation des Nichts.
Der polnische Regisseur Erioin Axer bietet eine verbal dichte Inszenierung. Kurt Beck ist ein herrisch vehementer Hamm, Kurt Sowinetz ein widerstrebend unterwürfiger Clov. Gespenstig tauchen die. Köpfe von Heinz Frölich und Bibiana Zeller, der Eltern, aus den Mülltonnen auf. Das Bühnenbild von Ewa Starowiey-ska stellt das Innere eines weißen Würfels dar. Ein runder Grundriß wäre geeigneter, da er dem Kreisen Clovs um den zentral sitzenden Hamm besser entspräche.
Gibt es heute noch gesellschaftliche Ächtung? Bürgerliche Schranken konnten sich noch um die Jahrhundertwende unmenschlich auswirken. Das zeigte der 36jährige Arthur Schnitzler in dem Schauspiel „Dos Vermächtnis“, das zuletzt vor 62 Jahren in Wien gespielt wurde und nun im Theater in der Josefstadt zu sehen ist. Ein junger Mann aus großbürgerlicher Familie gesteht erst nach einem Sturz vom Pferd sterbend den Eltern, daß er von seiner Geliebten, Toni, einem einfachen, herzenswarmen Geschöpf, ein vierjähriges Kind hat und verlangt, beide nach seinem Tod in die Familie aufzunehmen als sei dies eine legitime eheliche Beziehung gewesen. Das geschieht kurze Zeit, als aber das Kind stirbt, wird Toni mit dem Versprechen finanzieller Sicherstellung veranlaßt, die Familie zu verlassen. Sie begeht vermutlich Selbstmord.
Damit das Verhalten dieser Menschen um so herzlicher wirke, nimmt Schnitzler selbstverständlich bei Toni eine besonders starke, echte Liebe zum Verstorbenen, zum Kind an. Toni., gewinnt unsere Zuneigung. Die Einstellung aber, die verwehrt, sie in die Familie aufzunehmen, da dies als ein „Faustschlag“ gegen die Gesellschaft gesellschaftliche Ächtung zur Folge hätte, wird dadurch um so mehr in ihrer Unmenschlichkeit bloßgelegt. Menschliche Wärme, deren jeder Mensch bedarf, enthält man Toni vor. Schnitzler schrieb ein Tendenzstück, dem allerdings die Schnitzlerschen Zwischentöne fehlen.
In der von Regisseur Peter Vogel gut durchgetönten Aufführung ist Marianne Nentwich als Toni glaubhaft das liebende, verhärmte Geschöpf. Erik Frey gibt dem Vater der Familie, einem Professor und Abgeordneten, überzeugend die nötige Selbstgerechtiigkeit. Unter den sonstigen Mitwirkenden bewährt sich Alfred Reiterer in der Kälte des Eiferers. Ruhige Menschlichkeit wird bei Guido Wieland in der Rolle eines Arztes spürbar. Gerhard Janda entwarf einen großbürgerlichen Wohnraum.
Stücke, mit deren Hauptgestalten sich das Publikum identifizieren kann, sind meist erfolgreich. Das scheint sich bei dem Volksstück „Wahnsinnig glücklich“ von dem 27jährigen Helmut Zenker, das im Vol/cstheoter uraufgeführt wurde, zu bestätigen; dem Beifall bei der Premiere nach zu urteilen. Von Zenker, der kurze Zeit Sonderschul- und Hauptschullehrer in Wien und Tirol war, sind Gedichte im Bergland-Verlag und Romane bei Luchterhand erschienen. In diesem seinem ersten Stück führt er einen jungen Arbeiter und eine Schülerin der Handelsakademie vor, die einander lieben, die heiraten, als sie ein Kind erwartet, er wendet sich später kurz von ihr ab, kehrt aber wieder zurück. Das wird in 23 „Bildern“ in filmisch sehr loser Folge gezeigt. Was sich begibt, ereignet sich täglich, hebt sich davon in nichts ab, verebbt gegen Schluß hin; Die Gestalten sind aber gut beobachtet, krasse Ordinärheiten haben zuweilen Witz. Jener Teil des Publikums, der sich da wiedererkennt, ist entzückt. Aber es gibt noch ein anderes Publikum, das vom Theater mehr verlangt, als nur einen Abklatsch banaler Wirklichkeit. Wird Zenker auch diesem etwas zu bieten haben?
Spaß der Inszenierung unter der Regie von Rudolf Jusits: Die Drehbühne mit den Bühnenbildern von Kurt Conrad Loew rotiert immer wieder wie ein Ringelspiel. Treffliche Besetzung der zahlreichen Rollen, vorab mit Ilse Hatzfeld und Karlheinz Hackl als das junge Paar, mit Rudolf Strobl und Trude Hajek, Ludwig Blaha und Erna Schickel als deren Eltern. Derlei wird im Volkstheater vorzüglich gespielt. Weshalb aber im „Sonderabonnement“?
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!