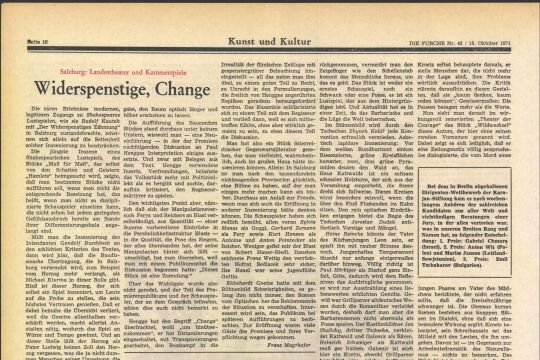Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Verbaler Salzburg-Auftakt
Das Herausbringen von Uraufführungen erhöht die Bedeutung von Festspielen. Es ist daher sehr zu begrüßen, daß beim Salzburger Festival heuer abermals im Landes-thea'ter ein neues, bisher unauf-geführtes Stück zur Diskussion gestellt wird, die Komödie eines Österreichers: „Die Macht der Gewohnheit“ von Thomas Bernhard. Mit diesem Namen ist die Gewähr starken Interesses der Theaterleute, wie der literarischen Kreise gegeben.
Es sind das drei Szenen im Wohnwagen eines Zirkusdirektors, die ihn, seine Enkelin, einen Jongleur, einen Dompteur, einen Spaßmacher vorführen. Abstruse Situation: Er zwingt sie, verschiedene Instrumente zu spielen, täglich mit ihm das „Forellenquintett“ zu proben, seit zweiundzwanzig Jahren, obwohl sie es nie zu Ende bringen. Die Konzentration soll dadurch nicht nachlassen. Er behandelt sie wie Tiere, alle hassen ihn, er aber fühlt sich hintergangen, ausgelacht. Ein Spannungszustand wird dargeboten, der sich das ganze Stück über nicht ändert. Was soll das?
Das Sprachliche ist zu beachten. Bei den Dialogen gibt es weder Punkt noch Beistrich, sie bestehen aus Bruchstücken von Sätzen, die keineswegs stets zusammenpassen oder, gegensätzlich dazu, wiederholen sich die gleichen Worte, wodurch Wortgirlanden entstehen, mitunter ergeben sich refrainartige Wirkungen. Endlos reden der Jongleur, der Dompteur und vor allem der Zirkusdirektor, der immer wieder völlig zusammenhanglos „Morgen Augsburg“ sagt. Eine derart ständige Wiederholung des Gleichen zeigt sioh auch sonst, dem Direktor entfällt dauernd das Kolophonium, das nun gesucht wird, er spielt auf dem Cello immer wieder nur den einen gleichen Ton. Elf Buchseiten lang rutscht dem Spaßmacher als Gag seine Haube herunter, man spricht noch und noch darüber.
Maoht der Gewohnheit? Monotonie der Gewohnheit. Was mit dieser artifiziell geführten Sprachdiktion ausgedrückt wird, ist fast ausschließlich Banales, Wird einmal etwas erzählt, wirkt es nahezu als Fremdkörper. Thomas Bernhard hat sich in den letzten Stücken einer hämischen Lebensfeindschaft, einem penetranten Lebenshaß ergeben, hier begnügt er sich damit, das Leben widerwärtig zu finden. Weshalb? Weil es ihm als sinnlos erscheint. Das Stück ist ein Gleichnis dafür? Da dürfte Bernhard aber nicht Menschen vorführen, die nur zu Banalitäten fähig sind, da müßte er schon höher greifen. Mit einem Geplätscher von Nichtigkeiten, die auch keineswegs eine Komödie ergeben, läßt sich nicht eine Frage dartun, die metaphysische Dimension erfordert. Die aber gänzlich fehlt.Was Beckett gelang, gelingt nicht Thomas Bernhard.
Der Regisseur Dieter Dorn 'tut alles, um diesen ermüdenden Text durch Dynamisierung szenisch wirksam zu machen. Eine großartige Leistung bietet Bernhard Minetti, der dem Zirkusdirektor präpotente Unausstehlichkeit, triumphale Überlegenheit von überzeugender Eindringlichkeit gibt. Fritz hichtenhahn als Jongleur, Hans Peter Hallwachs als Dompteur zeichnen intensiv diese Gestalten. Bruno Dallansky ist ein behäbiger, plötzlich schusselig werdender Spaßmacher von dumm-.siger Ergebenheit. Anita Lochner bietet als Enkelin stummes Spiel. Wilfried Minks führt als Bühnenbild einen Zirkuswagen im Längsschnitt vor, rahmt ihn vom Proszenium her mit weitausladenden weißen Vorhängen. Für die paar Kostüme zeichnen er und Johannes Schütz. Starker Beifall und zahlreiche Buhrufer.
„Jedermann“, das Spiel vom Sterben des reichen Mannes, wird heuer, wie im Vorjahr, in der von Ernst Häusserman erneuerten Max-Rein-hart-Inszenierung am Domplatz dargeboten. Umbesetzt sind nun der Spielansager mit Heinz Ehrenfreund und die Buhlschaft, für die Christiane Hörbiger an Stelle der erkrankten Senta Berger eingesprungen ist. Sie spielte diese Rolle früher, gibt ihr etwas von überlegener Weiblichkeit. Der wichtige Satz von der lohenden Feuerkraft der Reue wird wieder nicht gesprochen. Doch ist das Wort „Reue“ gleich anfangs entgegen Hofmannsthals Text eingesetzt. Am Schluß zusätzlich das Leichenbegängnis des Jedermann vorzuführen, stört den erreichten weihevollen Ausklang.
Auch heuer gibt es wieder Straßentheater unter der Regie von Oscar Fritz Schuh: Diesmal wird „Tritschtratsch“ von Johann Nestroy gespielt. Die Premiere fand abermals im Lehener Park statt, der sich hiefür besonders geeignet erweist, da eine Bodenwelle einer großen Zuschauerzahl die Sicht ermöglicht. Wieder fährt der Pawlatschenwagen, von schweren Pferden gezogen, mit den Darstellern vor, die Seitenwand wird heruntergelassen und schon beginnt das Spiel. Der vergnüglich primitiv wirkenden Bühne entspricht trefflich das mit leichter Hand nach einem Vaudeville hingeworfene Geschehen dieser Posse.
Worum kann es schon anders gehen als um eine Verlobung, der sich Hindernisse entgegensetzen? Das wogt hin und her, heiraten, nicht heiraten, doch heiraten, mit wahrer Besessenheit treibt das der Tabakkrämer Tratschmiedel an, der von sich behauptet, daß ihm nichts so fern liegt wie das Tratschen.
Diese Gestalt stellt Hans Putz mit solch komödiantischer Verve und verschmitzter Lust dar, daß sioh die Bretter biegen. Genau so muß das im Freien auf einem Pawlatschenwagen gespielt werden. Es macht Spaß, sich ins Zeitalter der Wandertruppen und ihrer unbeholfenen Bühnen rückversetzt zu fühlen. Aber auch Franzi Tilden als Marie, Gerhart Lippert als Gottlieb, Inge Wolffberg als dessen Tante, Anton Pointecker als Mariens vorgeblicher Vater und die übrigen Mitwirkenden spielen ihre Rollen, wie es sich gehört, kräftig aus.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!