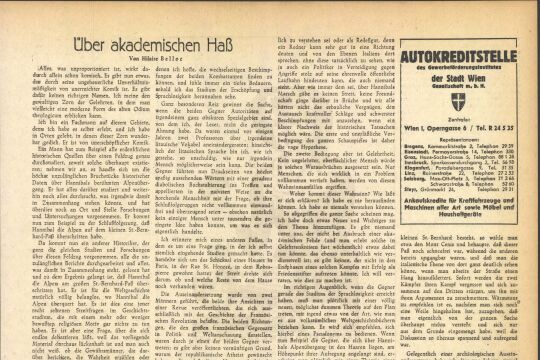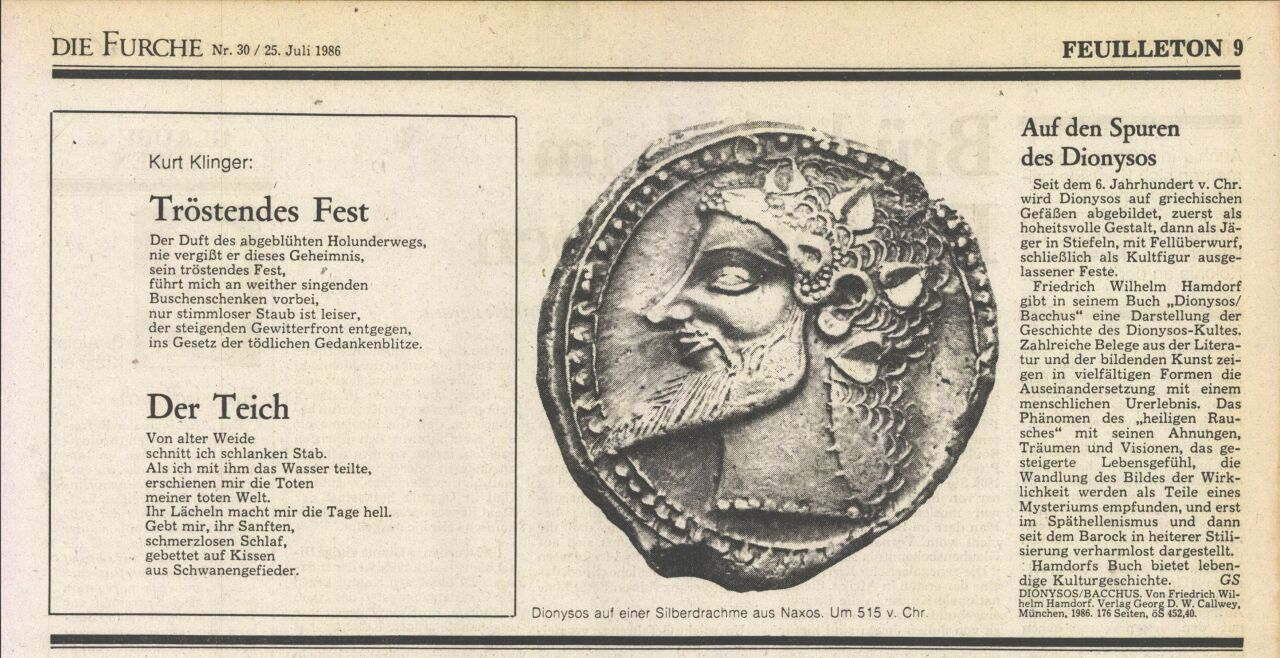
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Verbittert im Labyrinth der Vorurteile
Gerechtigkeit dürstet und alle kapitalistischen beziehungsweise staatlichen Privilegien verwerfen will, eigentlich nicht als „rechter Kulturkampf“, sondern als der natürliche Status des Menschen auf Erden anerkannt werden.
Michael Scharang jedoch stellt (in einer von mir hier sprachlich gemilderten Form) fest: „Wir stehen im Dreck.“ Aber auch nach dieser Feststellung treten sofort die Herkunft-und Eigentumsverhältnisse in den Vordergrund. Denn selbstverständlich ist es nicht der eigene Unrat, sondern — wie die essayistische Untersuchung erweist — der Dreck der anderen, in dem „wir“ stecken. Wer aber sind die anderen?
In dem Gespensterstück der Klischees, das hier inszeniert wird, treten sie allesamt auf: der Klassenverräter, der Ausbeuter, die buntscheckigen Reaktionäre und die intrigant nuschelnde Bourgeoisie. Für diese dramaturgisch bewährten Rollen hält Michael Scharang manch zündende Formulierung bereit, welche einer umsichtigen Parteiführung vielleicht ebensowenig
Im ersten Jahr litt Max so sehr, daß er fürchtete, dieses Maß an Demütigungen und Folterungen nicht ertragen zu können. Die Besuche zu Hause boten keine Hilfe. Da war die Mutter, deren Hauptsorge den beiden Töchtern galt; da war der Vater, der von seinen Leiden beim Militär erzählte und über die Sorgen des Sohnes nur lächelte. Max begriff das sehr bald, fügte sich in seine Rolle des jungen Männchens, das, wie überall in der Natur, von den Männern stets niedergetreten wird, berichtete daheim nichts mehr, diente sich hinauf in die zweite Klasse, kämpfte nun besser und schoß etliche Tore.
In der dritten war er über alle Hürden hinweg und gehörte zur Aristokratie. Plötzlich schien ihm alles weich und weibisch, was er anfangs für richtig gehalten hatte.
Die Welt ist anders und hat mit dem von den Patres gelehrten Christentum nichts zu tun. In der
behagt wie ehemals Savonaro-las Brandreden den florentini-schen Geistlichen.
Mag dem geschulten Marxisten auch der Ort der Handlung belanglos erscheinen, weil die Klassenstrukturen entscheiden und diese von Land zu Land unverändert bleiben, so fragt sich der Leser dann doch gelegentlich, wo dieses Gespensterstück spielen soll, wenn so viel von den „Herrschenden“, diesen Schlüsselfiguren des Bösen, gesprochen wird. Zum Schluß kennen wir ja doch vom Fernsehen her diese Leute. Und was man ihnen auch immer nachsagen oder vorwerfen mag: um die Urdä-monie des Bösen zu kreieren, wären sie selbst mit einem Shakespeare-Text völlig untauglich, geschweige denn mit den blassen Theorien Scharangs.
Sehr sympathisch jedoch berührt es, wenn der Autor gelegentlich zugibt, daß er ja schließlich selber auch ein Gespenst ist, das sich sektiererisch in einem Spukturm isolieren möchte oder dessen Trotz — offiziell in einer Ecke stehend, aber dort gesellschaftspolitisch liebevoll geschützt — fast poetisch strampelt, bis daraus eine Kunstauffassung und Weltall schauung wird.
Deshalb heißt das Buch auch völlig richtig: Die List der Kunst.
DIE LIST DER KUNST. Essays von Michael Scharang. Luchterhand Darmstadt, 1986, 103 Seiten.
Welt muß man bestehen, sich ohne moralische Hemmungen durchboxen. Worum geht es wirklich? Um die Stellung des Alpha-Wolfs, also Macht. Verachte die Schwachen, Verträumten, Feigen. Traue nicht deinem besten Freund, denn auch er könnte dein Feind sein oder es werden. Laß dich von den frommen Reden der Patres, der Journalisten, der Politiker und der Firmenchefs nicht beirren. Einziges Ziel: hinauf!
Nachdem er in kürzester Zeit sein Studium der sogenannten Jurisprudenz beendet hatte, hoffte Taferner auf den Eintritt des Sohnes in den Staatsdienst, Max aber ging weder dorthin, noch zu einem Anwalt oder in die Industrie, sondern zur Gewerkschaft, wo er es bald darauf schaffte, als Sekretär ins Büro eines damals mächtigen Ministers überzuwechseln.
Außer dem Doktorat hatte er keinen Titel, aber jeder wußte, daß er ganz oben landen würde, wenn ihn nicht die launische Politik zu Fall brachte. Er riskierte das, überlebte durch unauffällig erworbene Nebenbeziehungen den Sturz des Ministers und stand nun noch höher als bisher auf der Liste derjenigen, die irgendwann zum Zug kommen mußten.
Den Verstand hatte er also, und seine Gefühle wußte er zu zügeln. Mit nun sechsunddreißig Jahren war er noch nicht verheiratet, weil Ehe für ihn nichts mit Romantik zu tun hatte; ein Mann mit einem Ziel blieb am besten zunächst allein und suchte erst um die vierzig eine Frau, die dann allerdings auch etliches mitbringen sollte — nicht unbedingt Geld, Beziehungen waren besser, am besten und wichtigsten, daß man mit ihr repräsentieren konnte. Freilich gab es noch so etwas wie Sex, der für ihn - im Gegensatz zum Vater -durch kein Tabu belastet war. Aus Vorsicht vermied er längere Freundschaften, weil die leicht zu Verpflichtungen führten, auch wenn solche fairerweise von Anfang an ausgeschlossen worden waren. Komplikationen konnten kaum entstehen. Den Verlockungen der Korruption wußte er zu widerstehen, und für Homosexualität fehlte ihm jedes Verständnis, so daß auch aus diesen Richtungen keine Gefahren zu befürchten waren.
An den Vater dachte er zu Weihnachten, zu Ostern und zum Geburtstag. Aus dem Urlaub schickte er eine Ansichtskarte. Mutter, Geschwister hatte er vergessen.
Aus dem Roman „Die drei Kalender“, der demnächst im Paul Zsolnay Verlag, Wien, erscheinen wird.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!