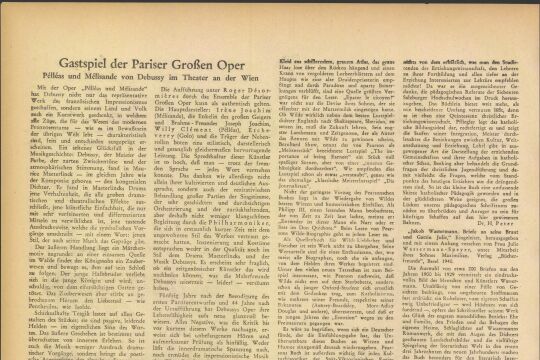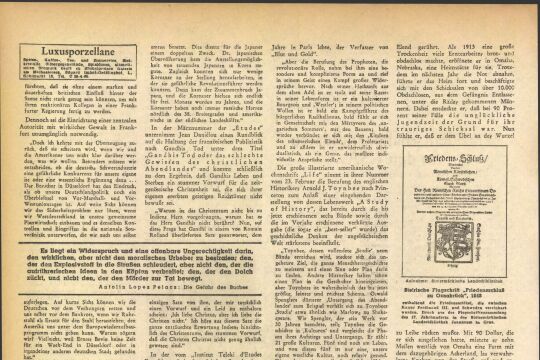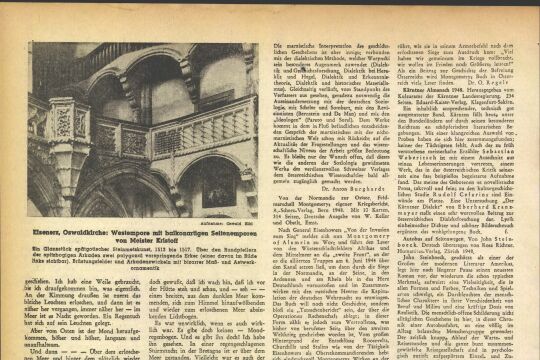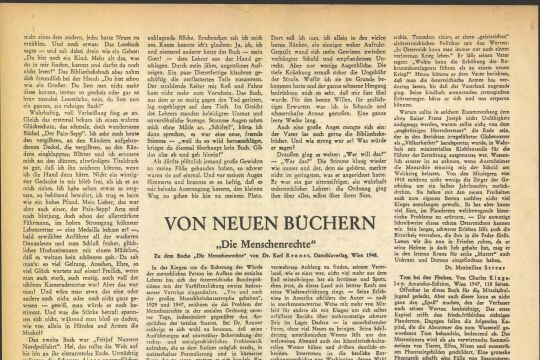Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Wildwest, Soldaten
Man muß schon ein wenig nachdenken, warum Peter Fondas Filmregiedebüt im Deutschen den Titel „Der weite Ritt“ bekommen hat — Vermutungen zu „Easy Rider“ tauchen auf, der Film, durch den Fonda jun. erst richtig berühmt wurde (es sind tatsächlich Parallelen vorhanden!), aber das spielt letztlich wenig Rolle, da der symbolisch verschlüsselte Originaltitel „The Hired Hand“ noch weniger klar ist; später kommt man darauf, daß damit jenes Zusammenreiten gemeint ist, das sieben Jahre lang zwei Satteltramps, einen jüngeren und einen älteren — später gesellt sich noch ein dritter dazu, der aber bald aus der Handlung wieder verschwindet —, auf ihren Fahrten durch den noch „Wilden Westen“ vereint. Den Jüngeren zieht es nach Hause zurück, es ist die Reife des Alterns, die Sehnsucht nach Geborgenheit. Wenn in ,,Easy Rider“ die beiden Protagonisten noch vom Fernweh, von der Ruhelosigkeit, der Suche nach einer schöneren Heimat getrieben waren, so ist es hier das Heimweh, die Ruhe, das Heim, das den Gereiften zu seiner Farm und seiner vor Jahren verlassenen Frau zurückführt. Er hat gefunden, was er all die Jahre auf Wanderschaft suchte — daß er dennoch nicht bleibt, daß ihm die Freundestreue über die Sicherheit geht (was er in einem völlig unpathetischen Showdown mit einem sinnlosen Ende bezahlt), läßt manchen Schluß zu: von stärkerer physischer Bindung zum Mann bis zu dem antiken Epilog von Schuld und Sühne, aber auch einer pessimistischen Hoffnungsleere... Diese hochaktuelle Problematik hat Fonda in seinem Erstling in die Form einer faszinierend photographierten, alle optischen Effekte vereinigenden kargen Westeraballade gebracht, die von jedem Klischee dieses Genres weit entfernt ist und eine künstlerische Kraft besitzt, die sie zum Meisterwerk stempelt. Die mitschwingende Romantik dokumentiert die Sehnsucht des jungen Amerika ng.eh dem verlorenen Paradies.
Das dritte Filmereignis des beginnenden Jahres bringt Wiens einziges Originalfassungen spielendes Kino (das schon allein deswegen Anerkennung in Form einer Subvention verdienen würde), nämlich den britischen antimilitaristischen Film „The Virgin Soldiers“; das bereits 1969 in seinem Ursprungsland erstaufgeführte Filmregiedebüt des hochbegabten jungen John Dexter entstand nach einem in England sehr erfolgreichen Buch (gleichen Titels) von Leslie Thomas, das die Zustände der Rekrutenausbildung und überhaupt der britischen (einer jeden) Armee anprangert und zeigt, was für eine Sorte von „Männern“ aus jungen Menschen gemacht wird, die einrücken müssen. Wenn diese halben Kinder — noch „jungfräulich“ nicht nur in ihren Sexualerlebnissen, sondern überhaupt in ihren Lebenserfahrungen — Soldaten werden, was lernen sie da?
Der Film gibt darauf die beste und treffendste Antwort. Dieses britische Gegenstück zu Kirsts „08/15“ zeigt dies jedoch nicht auf kraß-tendenziöse Art, mit deutscher Holzhammerschwere, sondern in der Form einer makabren Satire, einer bitteren Komik, einer zynischen Persiflage, die dennoch nie zur Karikatur ausartet. Hier sprechen die Figuren für sich — der separiert-vornehme Offizier, der „kameradschaftliche“ Feldwebel, der sadistisch-feige Unteroffizier —, stereotype, doch durchaus reale Gestalten, von denen die „unschuldigen Kinder“ ihre Erfahrungen für das Leben (oder den Tod) sammeln. Sie lernen sinnlose Rituale zu befolgen, Brutalität und Dummheit — so, reif für das Leben, werden sie dann, wenn sie Glück haben, entlassen ... Eine treffendere Kritik am Militär wurde wohl noch nie in einem Film dargestellt — und wohl noch kein Film verstand es auf so noble, eben britische Art, verbunden mit großartigen darstellerischen Leistungen und einer bewundernswerten Regie, dies aufzuzeigen. Ein Pflichtfilm nicht nur für Cineasten, sondern für alle Denkenden.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!