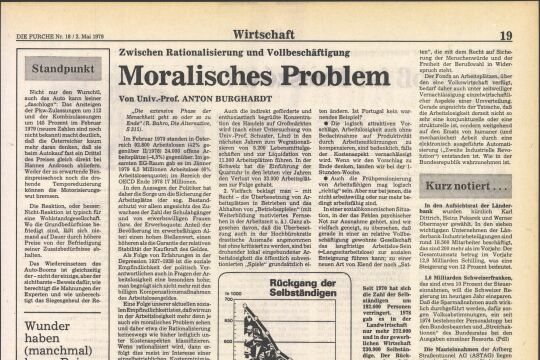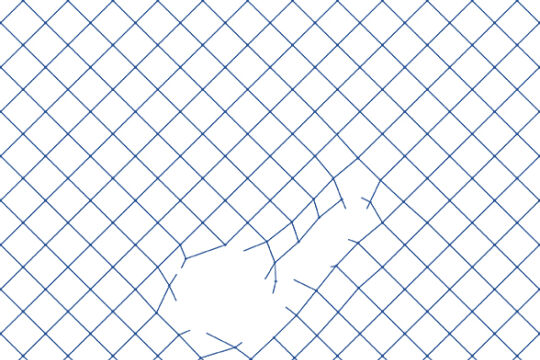Der Bund erschwert den Zugang zu den Pflegestufen. Das könnte sich rächen, meinen Experten. Die Pflege ist derzeit ein System ohne sichere Zukunft.
Zum Auftakt war der Minister zuversichtlich: "Die Pflege hat einen größeren Stellenwert, als vielfach wahrgenommen wird", versicherte Gesundheitsminister Alois Stöger (SPÖ) am 28. Oktober bei einem Pflegekongress in Wien. Viele der 3700 Teilnehmer zeigten sich befremdet. So etwa Walter Marschitz, Geschäftsführer beim Hilfswerk.Er kritisierte die geplante Einschränkung des Pflegegelds, auf die sich die Bundesregierung wenige Tage zuvor geeinigt hatte: "Es wird bei den Menschen gespart statt bei der Verwaltung." Das Pflegeproblem werde seit Jahren "zwischen den Gebietskörperschaften und dem Gesundheits- und Sozialbereich herumgeschoben".
Der erschwerte Zugang zu den Pflegestufen I und II - und damit zu Geldleistungen - stößt auf Widerspruch. Kritiker meinen, die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft würden überproportional zur Kasse gebeten. Das begründet etwa die Volkshilfe mit einer Studie, wonach Personen mit geringen Einkommen "gesundheitlich stärker vorbelastet" sind als Normal- und Besserverdiener. Daraus folgt ein höherer Pflegebedarf, dessen Abdeckung sie kaum finanzieren können. Eine fatale Situation, die durch das Regierungsvorhaben verschärft würde. Rudolf Kaske, Vorsitzender der Gewerkschaft Vida, bestätigt, dass öffentliche Dienstleistungen für viele Menschen wichtig sind, um der Armutsfalle zu entkommen. Wer bei Kinderbetreuung, Bildung und Pflege spare, "verringert die Chancengleichheit", sagt Kaske.
Skepsis gegenüber Beteuerungen
Exakt 353.971 Österreicher (davon zwei Drittel Frauen) waren 2009 pflegebedürftig im Sinne des Gesetzes. Fast 200.000 in den ersten beiden Pflegestufen. Für diese muss ein Pflegebedarf von "über 50" bzw. "über 75 Stunden" pro Monat vorliegen - künftig wird die Zugangshürde um je zehn Stunden erhöht. Zwar hat Sozialminister Rudolf Hundstorfer (SPÖ) versichert, es gebe "keinen Eingriff in bestehende Fälle". Unter Sozialexperten wird vermutet, bis zu 14.000 Pflegebedürftige könnten künftig niedriger und damit in Pflegestufe I eingeordnet werden. Damit erhielten sie eine monatlichen Geldleistung von 154,20 Euro - statt 284,30 Euro in Stufe II. An die 10.000 Menschen, die bisher in Stufe I gepasst hätten, würden ganz von den Zuschüssen abgeschnitten. Damit gehen andere Begünstigungen verloren: Wessen Pflegebedürftigkeit festgestellt ist, der kann etwa Zuschüsse für Fernsprechentgelte und eine ORF-Gebührenbefreiung beantragen.
Einsparung von 17 Millionen Euro
Für viele Menschen ist das Pflegegeld also "wesentliches Hilfsmittel für ein selbstbestimmtes Leben", betont Albert Brandstätter, Bundesgeschäftsführer der Lebenshilfe. Die drohenden Einbußen seien keine "statistische Spielgröße, die man bedauernd zur Kenntnis nehmen muss, weil halt alle gleich sparen müssen". Die Regierung erfreut sich dennoch an Zahlenspielen: 17 Millionen Euro sollen 2011 eingespart werden. 2012 könnten es 59 Millionen sein, und 2013/14 an die 100 bzw. 142 Millionen - ein Ausgabenminus von 7,6 Prozent, wenn man 2009 und die Ausschüttung von 1,87 Milliarden Euro über alle sieben Stufen als Basis nimmt.
Weniger Pflege ist später teurer
Das könnte sich rächen: Experten meinen, fehlende Pflege führe bei leicht Pflegebedürftigen rascher zur Unselbstständigkeit (siehe Interview unten), womit diese die höhere Pflegestufe III oder IV nötig hätten. 2009 hatten 31 Prozent der Bezieher diesen Bedarf. Genau 8,4 Prozent waren in Stufe V und nur fünf Prozent in den höchsten Stufen VI oder VII, für die 1242 Euro bzw. 1655,80 Euro monatlich zur Verfügung stehen.
Eine Studie des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (Wifo), die das Sozialministerium 2008 veröffentlichte, zeichnet die zunehmende Überalterung unserer Gesellschaft nach - fast 50 Prozent mehr 60- bis 79-Jährige und 73 Prozent mehr über 80-Jährige bis 2030. Daraus resultiert ein wachsender Bedarf an Pflegepersonal - auf professioneller wie ehrenamtlicher Basis - und dessen gesellschaftliche Aufwertung. Die Vorarlberger Soziallandesrätin Greti Schmid (ÖVP) verwies kürzlich darauf, dass 80 Prozent der Pflegebedürftigen daheim betreut würden. Ohne den "selbstlosen Einsatz pflegender Angehöriger" würde das System kippen. Die "rhetorische Anerkennung" der Pflegenden ist der Armutskonferenz zu wenig. Die Menschen bräuchten Unterstützung, die über reine Geldleistungen hinausgingen.
Künftige Finanzierung ungewiss
Trotz funktionierender Familien lohnt es sich, neue Finanzierungsmodelle ins Auge zu fassen.
Der Blick nach Deutschland zeigt eine durch Pflichtbeiträge finanzierte Pflegeversicherung: 1,7 Prozent des Bruttolohns, wobei finanzielle Leistungen im Pflegefall meist niedriger sind als in Österreich.
Die Niederlande kennen ebenfalls eine Versicherungspflicht, deren Bemessungsgrundlage "alle steuerpflichtigen Einkommensbestandteile" umfasst - auch Vermögenswerte. Das Wifo stellt fest, dass unter Einbeziehung der Vermögenseinkünfte in die Krankenversicherungspflicht das österreichische Beitragsaufkommen 2005 um rund 82 Milliarden Euro höher gewesen wäre. Die Abschaffung der Höchstbeitragsgrundlage hätte noch einmal 18 Milliarden Euro in die Sozialkassen gebracht.
Staatliche Subventionen gibt es übrigens auch für pflegende Angehörige. Die Pensionsversicherungsanstalt ermöglicht die beitragsfreie Weiterversicherung für Personen, die aufgrund ihrer Pflegetätigkeit aus dem bisherigen Beruf ausscheiden oder ihre Erwerbstätigkeit dafür verringern müssen. Beide Varianten, die im Oktober von 5010 Frauen und 562 Männern in Anspruch genommen wurden, ermöglichen eine laufende Pensionsversicherung aus Bundesmitteln - auf dass nicht die Selbstlosen später zum Sozialfall werden.
Diese Angst steckt in nicht wenigen Köpfen. Sollte die Regierung in der Pflegedebatte nicht grundsätzlich einlenken, könnte darum bald geschehen, was Gesundheitsminister Stöger beim erwähnten Pflegekongress seinem Publikum zurief: "Machen Sie Druck!"
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!