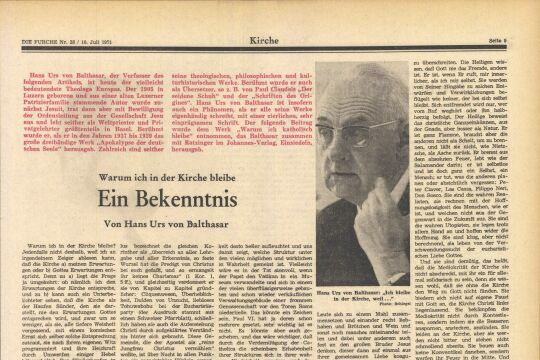Warum noch katholisch?
FOKUS
Wolfgang Beinert: Warum ich Christ bin
Wolfgang Beinert, der Altvordere der Theologie und Schüler Joseph Ratzingers, hofft, dass die Kirche für den Ostermorgen bereit wird – trotz aller Steine auf dem Weg.
Wolfgang Beinert, der Altvordere der Theologie und Schüler Joseph Ratzingers, hofft, dass die Kirche für den Ostermorgen bereit wird – trotz aller Steine auf dem Weg.
Im Baptisterium der Arianer zu Ravenna zeigt ein Mosaik den leeren Thron Gottes, umgeben von den Apostelfürsten, die sich verneigen. Vor dem Thron das edelsteinbesetzte leere Kreuz. Hetoimasia heißt dieser Darstellungstypus: Bereitung der Wiederkunft Christi. Es geht um die absolute Zukunft. In dieser Ikone finde ich dargestellt, warum ich Christ bin.
Erstens bin ich Christ, weil ich getauft bin und damit Glied der Kirche des dreieinen Gottes. Das ist mir gegeben worden; ich habe es nicht gesucht. Ich war ein Säugling.
Ich bin Christ, zweitens, weil der im Sakrament grundgelegte Christus-Glaube hat wachsen dürfen. Das geschah durch heiligende Menschen – voran die gelassene Katholizität der Eltern, einige Priester, viele Lehrer, Freundinnen und Freunde – und auch die, welche mir das Leben schwer machen wollten.
Christ bin ich, zum Dritten, weil sie mich die Erfahrung machen ließen, dass Gott der absolute Ursprung ist. Was mir gewärtig ist, die Welt, ist ihm verdankt; er hat alles, was nicht er ist, werden lassen, um seine souveräne Liebe über sich selbst hinaus Gestalt annehmen zu lassen. So ist er der Ursprung, welcher der Schöpfung so gleichzeitig ist wie das Wasser aus der Quelle dem ganzen Strom. Dann aber ist es Aufgabe der Geschöpfe, besonders jener, die seine Ebenbilder sind, den gegenwärtigen Gott als den Gegenwärtigen erfahrbar, sichtbar, liebenswürdig zu machen und damit seiner Herrlichkeit unter uns Zukunft bei den nachfolgenden Generationen zu geben, bis er den Thron wieder einnimmt. Das ist der Christinnen und Christen, also auch meine Aufgabe.

Liebe Leserin, lieber Leser,
diesen Text stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung. Im FURCHE‐Navigator finden Sie tausende Artikel zu mehreren Jahrzehnten Zeitgeschichte. Neugierig? Am schnellsten kommen Sie hier zu Ihrem Abo – gratis oder gerne auch bezahlt.
Herzlichen Dank, Ihre Doris Helmberger‐Fleckl (Chefredakteurin)
diesen Text stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung. Im FURCHE‐Navigator finden Sie tausende Artikel zu mehreren Jahrzehnten Zeitgeschichte. Neugierig? Am schnellsten kommen Sie hier zu Ihrem Abo – gratis oder gerne auch bezahlt.
Herzlichen Dank, Ihre Doris Helmberger‐Fleckl (Chefredakteurin)
Der vierte Grund meines Christseins: Weil der Ursprung Freiheit ist und Freiheit schenkt, ist das Problem des Leidens und Leides in der Welt zu ertragen, auch das meine. Die ursprüngliche Gabe Gottes an seine Gleichbilder ist die Teilgabe an seiner Freiheit. Dem Ursprung Zukunft geben bedeutet also, frei zu sein und frei werden zu lassen – bis hin zur Einsicht, dass geschöpfliche Freiheit auch Freiheit zum Bösen ist und also Leid und Leiden schafft. Deswegen ist ja der Thron Gottes leer und nur ein leeres Kreuz ist übrig. Gott ist ganz und gar heruntergekommen in Solidarität zu und mit uns heruntergekommenen Menschen: „Hinabgestiegen in das Reich des Todes“, lautet die Chiffre des Großen Glaubensbekenntnisses. Tod ist mehr als Exitus. Er ist die Summe des bedrängenden Bösen. In des Todes Tiefen aber beginnt die Erhöhung auf den Thron Gottes – für seinen eingeborenen Sohn und alle anderen Kinder Gottes. So ist Ostern die Peripetie des Schöpfungsdramas. Also ist Ostern das Signal für die Freiheit, also auch für das Christsein. Das Kreuz bleibt leer, der Thron mitnichten.
Fünfter Grund: Ich bin Christ, weil Jesus die Radikalität des Ursprungs gelebt, gepredigt, durch seine Gnade ermöglicht hat. Darin eben besteht Kern und Mark seines Evangeliums. Im Disput mit den Autoritäten seines Volkes über die Ehedauer berufen diese sich auf das Uralte: des Mose Scheidebriefregelung, er auf den Urwillen des Schöpfers (Mt 19,3–13). Er macht die Verbindung der Geschlechter zum Zeichen seiner Liebe: Er ist zu uns wie der junge Mann des Hohenliedes zu seinem Mädchen. Weil sie dem Ursprung entspringt, kann Liebe wegen ihrer Kreatürlichkeit in sich zerfallen, sterben, zerbrechen, aber nicht von außen getrennt werden. Die gleiche Intention treibt alles, die Worte wie die Taten und das Scheitern des Mannes aus Nazaret: Er will die Ordnung des Anfangs, die Einheit Gottes mit der Menschheit. Er verkündet: Wo die Menschen wieder ursprünglich werden, geschieht das Reich Gottes: Sein Wille geschieht – und der ist unser grenzenloses Glück.
Ich bin, schlussendlich, gerade deswegen (immer noch) Christ, weil die Kirchengestalt zusammengebrochen ist, in der ich lebenslang gefangen war. Die grundstürzende Kirchenkrise dieser Jahre ist der eigentliche Anlass, dass Kirchen-Christ zu sein, begründungspflichtig geworden ist. Wer also beansprucht, Glied der Glaubensgemeinschaft heute zu sein, muss Rechenschaft geben, damit man ihm das abnimmt. Das ist schon das grellstmögliche Signal für ihren Zustand! Wir müssen zunächst nach den Ursachen suchen.
Seit der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts ist die von der Neuzeit traumatisierte Glaubensgemeinschaft in einem regressiven Antimodernismus erstarrt. Ihren Leitern war ein folgenschwerer Irrtum unterlaufen: Sie verwechselten den Ursprung mit dem Anfang. Damit machten sie den gleichen Fehler wie ihre Vorgänger auf der Kathedra des Mose zu Jesu Zeiten. Gegenüber dem Neuen der Neuzeit verschanzten sie sich im Alten der Vorzeit als dem Maßstäblichen. Doch der Ursprung ist zeittranszendent und also jeder Zeit als Norm gegeben. Er ist das alles Zeitliche Begründende. Das Alte hingegen ist ein Punkt der Zeit, der mit der Zeit gehen muss, weil er mit der Zeit nicht gehen kann. Es ist wie ein Untoter, der allenfalls animiert, nie aber reanimiert werden kann. Der Parteigänger des bloß Alten schaut auf einen einzigen Punkt der Zeit und verdammt alle anderen Zeitpunkte als Erzeugnisse des Zeitengeistes. Damit aber steht er in ständiger Gefahr, den Heiligen Geist zu übersehen, der in der Zeit wirkt – wo anders denn sonst, wenn er wirken will? Wenn das so bliebe, bliebe die Hetoimasia aus, der Thron leer und Ostern eine Fabel aus uralten Zeiten.
Seit anderthalb Jahrhunderten droht die Kirche dieser Gefahr zu erliegen. Indem sie das Alte kanonisierte, sprach sie sich selber heilig. Im Handstreich besetzte sie den leeren Thron: Sie gab vor, nicht mehr Weg, sondern Ziel zu sein. Sie stilisierte sich als „fortlebenden Christus“, als „bereits gekommenes Gottesreich“ und konzentrierte diesen Anspruch in der Gestalt des Papstes. Im 19. Jahrhundert sangen die Leute statt „Te Deum laudamus“: „Te Papam laudamus“. Das aber hielt die Kirche nicht aus. Sie versank in einer Krise, deren Ursprung sie nahezu allein ist. Sie gab sich als Haus voll Glorie, und ist doch nur „Feldlazarett“, „zerbeultes“ Gefäß (Papst Franziskus). Nicht dass Kirchenleute sexuell gegenüber Minderjährigen übergriffig wurden, ist der Super-GAU gewesen, sondern dass deren Vorgesetzte beharrlich die Flecken verstecken wollten, damit der Glorienglanz sie überstrahle.
Nochmals: Aus diesem Lügengeflecht auszubrechen um der eigenen Ehrlichkeit willen, ist fast selbstverständliche, zu respektierende Reaktion. Viele, immer mehr Kirchenmitglieder zeigen sie. Zwangsläufig ist sie nicht. Für mein Teil bleibe ich Christ in der Kirche, weil ich schon zu sehen meine, dass der Abstieg der Jünger Christi in die „Tiefen des Todes“ dem Ende sich zuneigt. Ich vermag auszumachen, dass die Bereitschaft zur Reform wächst – und damit die Bereitung auf den Ostermorgen. Der Ursprung hat neue Zukunft. Hetoimasia ist neu gegeben.
Denn die Erkenntnis scheint zu wachsen: Kirche ist ganz und gar nicht das Reich Gottes, sondern der steinig-staubige Weg zu diesem Ziel. Wir lernen neu: Kirche eint uns nicht automatisch mit Gott, sie ist nur Sakrament, Zeichen und Werkzeug dieser Einheit (so das Konzilsdokument „Lumen gentium“), die Er in Seinem Heiligen Geist endgültig wirkt. Zeichen können unkenntlich, schmutzig, verfallen sein. Gott, der Ursprung, kann auch ohne sie zu seiner Liebe führen. Von neuem werden wir uns bewusst: Kirche definiert sich nicht dann von ihren Oberen her, sondern ist Gemeinschaft in Vielfalt und Diversität, Gemeinschaft auf dem Weg aus der Todestiefe hin zu Gottes Thron. Wir lernen, Ekklesiologie neu zu buchstabieren. Das Resultat des Studiums: Der Christenmensch von heute hat nicht auszutreten, aber kräftig aufzutreten.
Ich bin also immer noch Christ, weil es sich immer noch und immer mehr lohnt, dem Ursprung hier und heute Zukunft zu geben. Ich neige mich voller Zuversicht vor dem leeren Thron der Hetoimasia wie Petrus und Paulus in Ravenna.
Der Autor, Jg. 1933, war 1978–98 Professor für Dogmatik an der Uni Regensburg, wo bis 1977 Joseph Ratzinger lehrte, dessen Schüler Wolfgang Beinert ist.
Dieser Text erschien unter dem Titel "Dem Ursprung Zukunft geben" in der FURCHE 15/22.

Hat Ihnen dieser Artikel gefallen?
Mit einem Digital-Abo sichern Sie sich den Zugriff auf über 175.000 Artikel aus 40 Jahren Zeitgeschichte – und unterstützen gleichzeitig die FURCHE. Vielen Dank!
Mit einem Digital-Abo sichern Sie sich den Zugriff auf über 175.000 Artikel aus 40 Jahren Zeitgeschichte – und unterstützen gleichzeitig die FURCHE. Vielen Dank!
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!