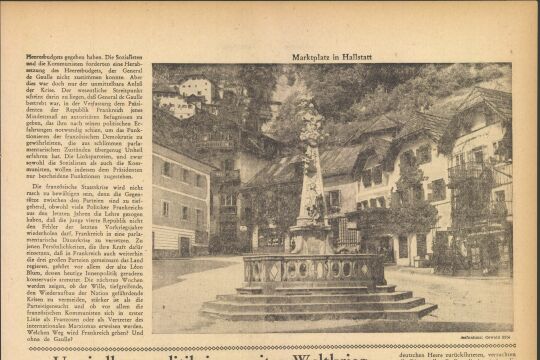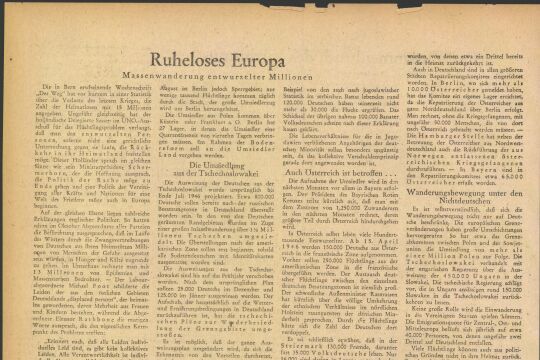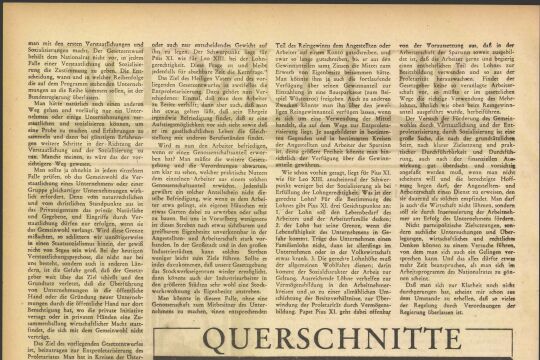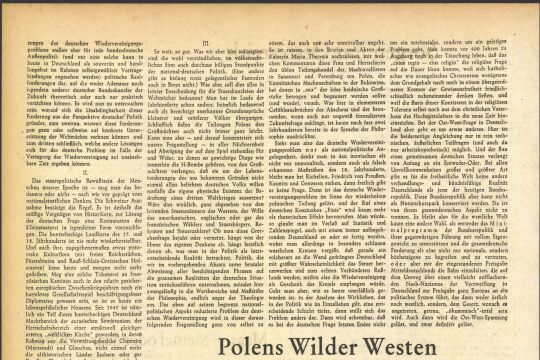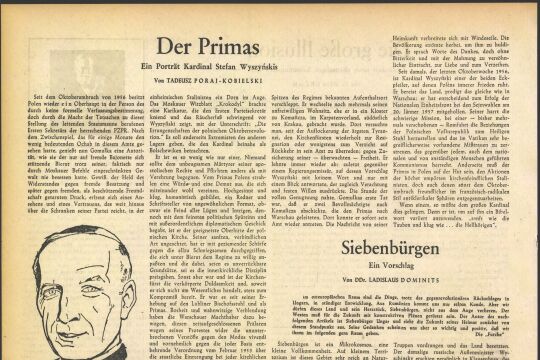Seit dem 12. Jahrhundert gibt es eine deutschsprachige Minderheit in Siebenbürgen. Stark dezimiert durch Abwanderung nach 1989, erwacht nun ein neues Selbstbewusstsein.
Hoch über Michelsberg thront eine romanische Kirche auf einem Hügel. Vor der Hochzeit, so wollte es das Brauchtum der Siebenbürger Sachsen, musste der Bräutigam einen schweren runden Stein den Weg hinauf bis zur Kirche rollen. Das war kein Mannbarkeitsritual, bei dem die jungen Männer ihre Körperkraft unter Beweis zu stellen hatten, sondern hatte praktische Gründe. Wann immer der Feind kam, pflegten sich die Michelsberger auf dem Hügel zu verschanzen. Die Steine wurden dann lawinenartig gegen die Angreifer eingesetzt. So manche Gefahr konnte abgewehrt werden.
Als Michael Henning seine Frau Emmi vor den Traualtar führte, musste er sich nicht mehr den strengen Ritualen seiner Heimatgemeinde unterwerfen. „Die letzte Hochzeit in Tracht fand Mitte der 1970er Jahre statt. Wir haben Ende der 1980er geheiratet“, erzählt der Postmeister. Damals war Michelsberg, wenige Kilometer südlich der Kreishauptstadt Hermannstadt/Sibiu gelegen, noch eine Hochburg der Siebenbürger Sachsen, die dort 800 Jahre lang die Bevölkerungsmehrheit gestellt hatten. Heute sind sie mit 100 Männern, Frauen und Kindern nur mehr eine deutlich wahrnehmbare Minderheit gegenüber den zugewanderten Rumänen.
Saxones vom Rhein
Seit der ungarische König Geza II (1141–1162) Siedler aus dem Rhein- und Moselgebiet sowie aus Wallonien holte, um den südlichen Karpatenbogen gegen Einfälle feindlicher Heere aus Asien dicht zu machen, leben deutschsprachige Gruppen in Siebenbürgen. Saxones nannten sie die Ungarn, die bei den Germanen nur zwischen Bajuwaren und Sachsen unterschieden. Mit den Sachsen im heutigen Ostdeutschland haben sie nichts zu tun. Der Kern des Siedlungsgebietes liegt dort, wo die Olt, ein Nebenfluss der Donau, eine Kerbe in die Südkarpaten schlägt und den Durchmarsch für Reitertruppen ermöglichte. Im 17. Jahrhundert folgten dann die sogenannten Donauschwaben, die Kaiser Leopold I. in das von den Türken eroberte aber durch die Kriege weitgehend entvölkerte Banat schickte. Ergänzt wurde die deutschstämmige Bevölkerung unter Kaiser Karl VI. und Maria Theresia durch die Landler: protestantische Bauern vor allem aus Oberösterreich und Kärnten, die während der massiven Rekatholisierung im 18. Jahrhundert ihrem lutherischen Glauben nicht abschwören wollten und an die äußerste Reichsgrenze verbannt wurden.
Die Siebenbürger Sachsen, wie sie noch immer genannt werden, genossen Jahrhunderte lang bedeutende Privilegien: Sie waren freie Bauern, unterstanden also keinem Landesherrn und konnten ihre Angelegenheiten weitgehend selbst regeln, mussten aber auch für ihre eigene Verteidigung sorgen. Mehr als 150 noch erhaltene mittelalterliche Wehrkirchen – Kirchenburgen genannt – zeugen heute noch davon. Dadurch entwickelten sich extrem starke Traditionen, die in den Nachbarschaften verankert waren. Im Rahmen der Nachbarschaften war jeder verpflichtet, dem anderen etwa im Fall eines Brandes oder anderer Unglücksfälle beizustehen, bei der Ernte zu helfen und die Bestattung zu regeln. Wer gegen die äußerst rigiden Regeln verstieß, wurde bestraft, wer als Störenfried empfunden wurde, konnte aus der Dorfgemeinschaft verstoßen werden.
Als Kind habe er die Traditionen noch erlebt, erinnert sich Michael Henning: „Der Altnachbar musste geehrt werden, die Amtsübertragung fand in Tracht und mit Blasmusik statt. Aber das war damals schon sehr locker.“ Während der kommunistischen Zeit wurden die strengen Regeln aufgeweicht. Henning: „Den Kommunismus hat keiner ernst genommen aber von den Alten wollten wir uns auch nicht mehr so viel sagen lassen.“
Doch auch unter dem stalinistischen Diktator Nicolae Ceaucescu blieb die Minderheit der „Sachsen“ eine verschworene Gemeinschaft. An Feiertagen wurden die Trachten angelegt, die Sprache und Kultur wurde gepflegt. Verglichen mit der Zeit der ungarischen Herrschaft waren die Freiräume groß. Denn die schwerste Unterdrückung hatte die Volksgruppe zu erleiden, nachdem Ungarn 1867 in der k.u.k. Monarchie ein weitgehend eigenständiger Staat geworden war. Deutsche Schulen kamen unter Druck, alle Namen mussten magyarisiert werden. Kein Wunder, dass die „Sachsen“ nach dem Ersten Weltkrieg für das neue Rumänien optierten, das ihnen große Autonomie versprach, dann allerdings im Zuge einer weitgehenden Agrarreform das Land wegnahm.
Was weder die Ungarn noch die Kommunisten zustande brachten, kam dann als Folge der Freiheit. Mit der Wende 1989/1990 setzte ein Exodus ein, der mehr als 800 Jahren Tradition beinahe den Todesstoß versetzte. Mehr als 90 Prozent der Siebenbürger Sachsen wanderten binnen weniger Monate nach Deutschland aus. Im Kreis Hermannstadt habe der Anteil der „Deutschen“ bis dahin über 20 Prozent betragen. „Bei der Volkszählung 2002 waren es nur mehr 1,5 Prozent, knappe 6000 Menschen“, berichtet Martin Bottesch, der Vorsitzende des Kreisrates. Dass auch die Landler nach Deutschland emigrierten und nicht in die Heimat der Vorfahren, hat für Martin Bottesch, selbst ein Landler, ganz pragmatische Gründe: „Österreich bot keine schnelle Einbürgerung an und war auch bei der Anrechnung von Pensionszeiten viel weniger großzügig.“
Der Exodus
Michael Henning, der im Nebenberuf Ofenkacheln entwirft und brennt, hat in seiner Werkstatt die Porträts eines sächsischen Ehepaares hängen. Nein, es seien nicht die eigenen Urgroßeltern, die Bilder habe er aus dem Mist gerettet. Die Auswanderer ließen alles, was sie an die alte Heimat band, zurück. „Die Mülltonnen waren voll mit Trachtenstücken. Die Leute haben sie weggeschmissen.“ Henning erkannte schnell, was da an Geschichte vernichtet wurde: „Ich habe gesagt, ich mache zu Hause eine Kiste, da können sie Sachen hineintun. Mich interessieren vor allem alte Fotos.“ Kein Einziger sei gekommen: „Aber verbrannt haben sie wie verrückt.“ Rückblickend hat der Postmeister Verständnis für diese Zerstörungswut: „Man hätte sonst nicht in Deutschland ankommen können, wenn man das alles im Gepäck mitgenommen hätte. Das war psychologisch richtig so.“
Der Exodus stellte auch die evangelischen Kirchengemeinden vor Existenzprobleme. Zahlreiche Kirchen mussten geschlossen werden. Wertvolle Archive, die vor türkischer Brandschatzung, Unwettern und versuchtem Zugriff des kommunistischen Regimes gerettet worden waren, drohten jetzt verloren zu gehen. Die meisten Bestände konnten aber im Evangelischen Zentralarchiv in Hermannstadt untergebracht werden. „Die Erinnerung sollte bleiben, man hat angefangen, die Archive zu retten und irgendwo zu deponieren“, erzählt Wolfgang Rehner, pensionierter Stadtpfarrer von Hermannstadt, der sich mit der Aufarbeitung der Dokumente beschäftigt. Anfangs sei dabei wenig fachmännisch vorgegangen worden und habe die Bestände, aus der Not heraus, irgendwo zwischengelagert. Schließlich sei das Gebäude im Zentrum von Hermannstadt für diesen Zweck renoviert worden.
Sächsische Bürgermeister
Heute leben die Siebenbürger Sachsen und die anderen Volksgruppen, die sich dem deutschen Kulturkreis zurechnen, nicht mehr von der Vergangenheit. Vielmehr scheinen sie im neuen Rumänien ihren Platz gefunden zu haben. Martin Bottesch wurde von einer rumänischen Mehrheit zum Kreisratsvorsitzenden gewählt. Und der Hermannstädter Bürgermeister Klaus Johannis macht seine Sache offenbar so gut, dass er 2008 mit mehr als 80 Prozent der Stimmen bereits zum zweiten Mal wiedergewählt wurde. Auch in kleineren Gemeinden, wo der Anteil der „Deutschen“ kaum zwei Prozent beträgt, regieren „sächsische“ Bürgermeister. Das Deutsche Forum, das Parteistatus hat, ist ideologisch nicht klar definiert und kann mit den meisten Parteien zusammenarbeiten. Das macht dessen Kandidaten für die von Korruption und Parteienfilz frustrierten Wähler attraktiv. „Außerdem“, so Martin Bottesch, „erwartet man von uns gute Kontakte nach Österreich und Deutschland, damit die Investoren kommen.“
Arnold Klingeis, der erst 32-jährige Bürgermeister der kleinen Gemeinde Freck, ist so ein Mann, der nicht nur Kontakte nach Westeuropa knüpft, sondern ein riesiges EU-Programm an Land gezogen hat, das es ihm ermöglichen würde, aus Freck eine energieautonome Stadt und ein Vorzeigeprojekt für erneuerbare Energie zu machen.
In den letzten Jahren sind nur mehr wenige ausgewandert. Wer geblieben ist, der hat sich eingerichtet obwohl Lohnniveau und Lebensstandard noch immer hinter den deutschen Verhältnissen zurückliegen. „Früher war Deutschland unendlich weit weg“, fasst Michael Henning den Unterschied zur alten Zeit zusammen: „Grenzen, Visa, schlechte Straßen. Wenn ich heute Sehnsucht nach Deutschland habe, dann setze ich mich ins Auto und fahre hin.“
* Reportage Ralf Leonhard, Michelsberg
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!