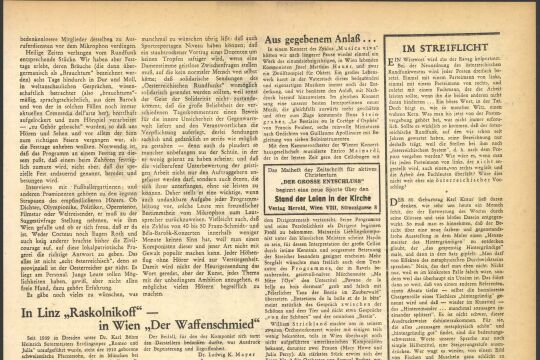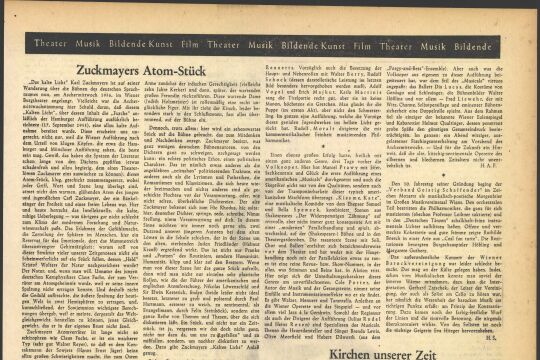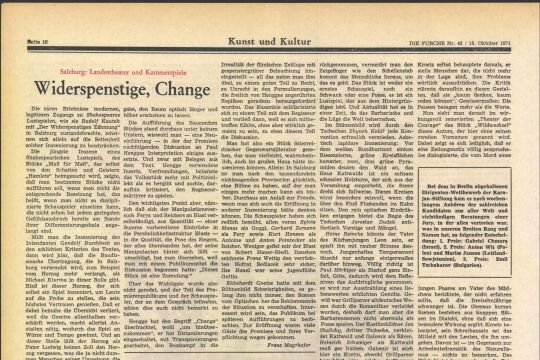"Der Freischütz" in Salzburg: Holzhammer-Regie ohne eigene musikalische Handschrift.
Die Gesellschaft teilt sich in Gewinner und Verlierer - in die ewig Jungen, Schönen, Erfolgreichen, Coolen und die Hässlichen, Übergewichtigen, schlecht Gekleideten, von denen kein Society-Magazin, kein Zeitgeist-Medium je Notiz nimmt. Max und Agathe sind weder jung noch schön noch cool, doch ihnen bietet sich die einmalige Chance, dem Mittelmaß zu entrinnen. Max muss nur seine Fertigkeiten im Schießen unter Beweis stellen und er bekommt Agathes Hand und einen guten Job.
Doch er muss erkennen: um dazu zu gehören, um Erfolg in dieser Gesellschaft zu haben, muss man sich mit dem Bösen einlassen, muss man seine Ellenbogen einsetzen, muss man Gesetze brechen, muss man dopen. Denn das Böse haust nicht irgendwo im finsteren Wald, sondern inmitten der Gewinner, ja scheint geradezu Voraussetzung für deren Erfolg zu sein.
Das Böse führt zum Erfolg
So ungefähr sieht Regisseur Falk Richter Carl Maria von Webers Oper Der Freischütz, zumindest teilweise. Die andere Sicht ist, dass der Freischütz vom Krieg handelt, die Jäger Scharfschützen einer Eliteeinheit sind, der Jägerchor ein Militärchor ist, das Schützenfest als Rekrutierungsveranstaltung dient und das ganze in einer Art Bunker spielt. Beides - die Glitzerwelt des Erfolgs und die raue Welt der Krieger und Söldner - passt freilich nicht recht zusammen.
Und dies ist auch nicht die einzige Schwäche von Richters greller Inszenierung voller populärkultureller Anspielungen und Bezüge bei den Salzburger Festspielen. Sie kommt nämlich nicht subtil daher, sondern mit dem Holzhammer.
Im Besonderen tritt dies in der geschwätzigen Neufassung des Librettos zu Tage, die Samiel (Ignaz Kirchner) zwei Gehilfen zur Seite stellt (Rafael Stachowiak und Sven Dolinski) und die drei zu omnipräsenten, das Geschehen lenkenden und kommentierenden Gestalten macht, die Sätze wie "Frauen mögen keine Verlierer" von sich geben. Zur allgemeinen Plattheit gesellt sich noch plumper Antiamerikanismus, etwa wenn die Samielgehilfen mit Blut In God we trust an die Wand schmieren.
Holzhammer-Regie
Auch mit der musikalischen Umsetzung kann man im Haus für Mozart nicht zufrieden sein. Dirigent Markus Stenz ist es nicht im Mindesten gelungen, eine eigene Handschrift erkennen zu lassen. Warum Der Freischütz einen Meilenstein auf dem Gebiet der Klangfarben darstellt, lässt sich nur ansatzweise heraushören.
Die Wiener Philharmoniker klingen einfach nur nach Wiener Philharmonikern, ein Einheitssound irgendwo zwischen Mozart und Neujahrskonzert. Natürlich gelingen einem Orchester dieser Klasse große Momente, wenn es nach eigenem Gutdünken an eine Partitur herangeht: So geraten die Wolfsschluchtmusik und die (Streicher-)Klänge zu den Arien von Agathe zu echten Leckerbissen. Wie die Philharmoniker hätte auch so manche Stimme eines musikalischen Leiters bedurft.
Jemand hätte zum Beispiel Petra Maria Schnitzer deutlich machen müssen, dass für die Partie der Agathe virtuos dargebotene Innigkeit allein nicht genügt, sondern auch dramatische Akzente zu setzen sind. Wenn keine der gesanglichen Leistungen als herausragend in Erinnerung bleibt, so liegt das zu einem guten Teil an der offenbar fehlenden Lenkung und Leitung.
Sänger allein gelassen
Mit viel Schmelz, der so gar nicht zu der von der Inszenierung vorgegebenen Rolle passen mag, gibt Peter Seiffert den "Jägerburschen" Max als ältlichen Biedermann mit Schnauzbart. Solide Arbeit liefern John Relyea als Kriegsveteran Kaspar, Markus Butter als Fürst im Karl-Heinz-Grasser-Look und Günther Groissböck als Eremit in der Gestalt eines Bösewichtes, der einem in der Gegenwart spielenden Fantasyfilm entsprungen scheint. Tadellos die Brautjungfern (Hannelore Auer, Cornelia Sonnleithner, Yoko Ueno, Arina Holecek) und Roland Bracht als Kuno. Ein wenig indisponiert wirkte Aleksandra Kurzak in der Partie des Ännchens.
Eine letzte Anmerkung noch zu dieser eher missglückten Aufführung: Bei fremdsprachigen Opern gehören deutsche Übertitel mittlerweile zum Standard. So sollte es auch bei deutschsprachigen sein. Es kann nicht sein, dass das Publikum beim Freischütz weniger vom Text mitbekommt als beispielsweise bei Tschaikowskis Eugen Onegin.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!