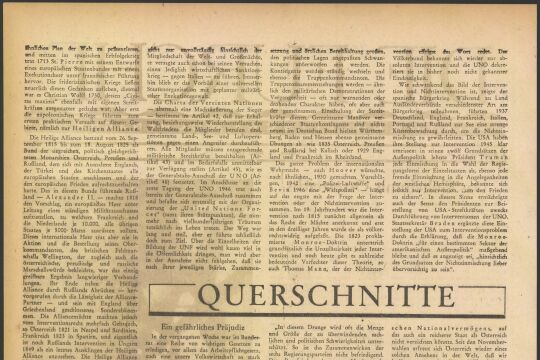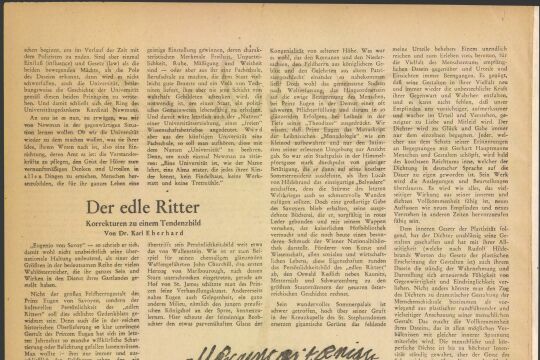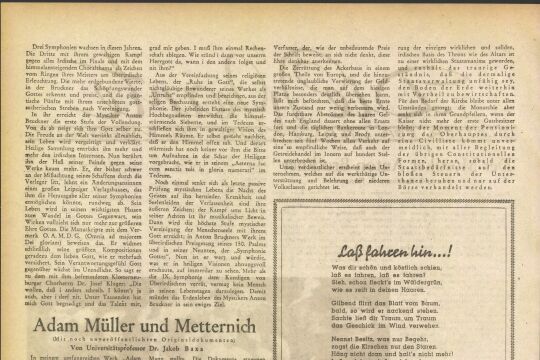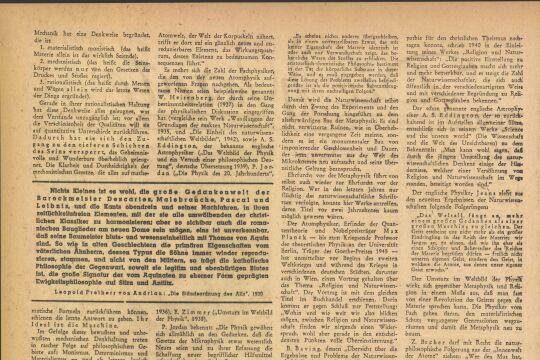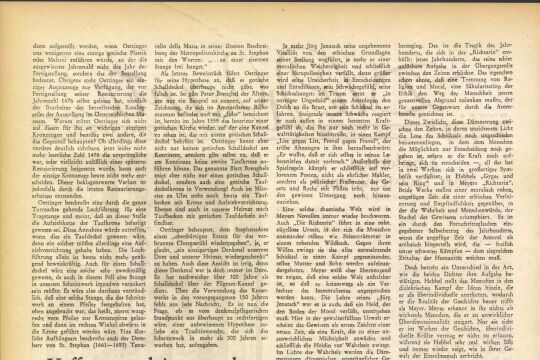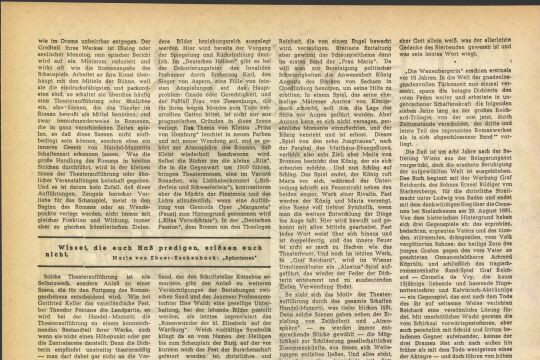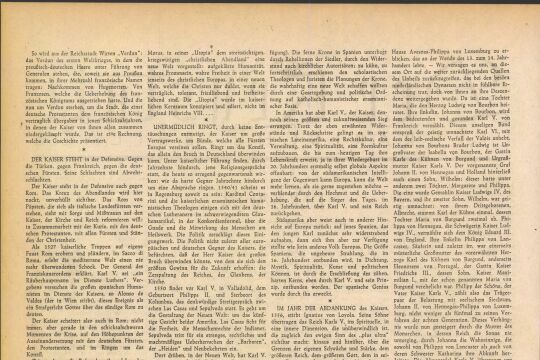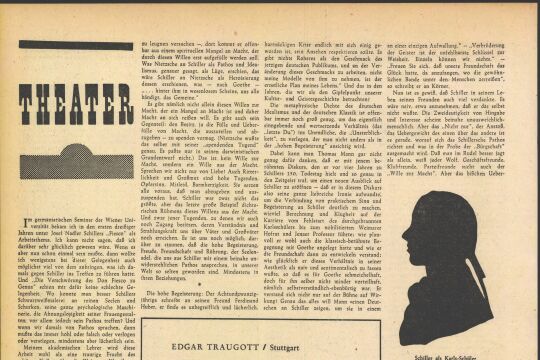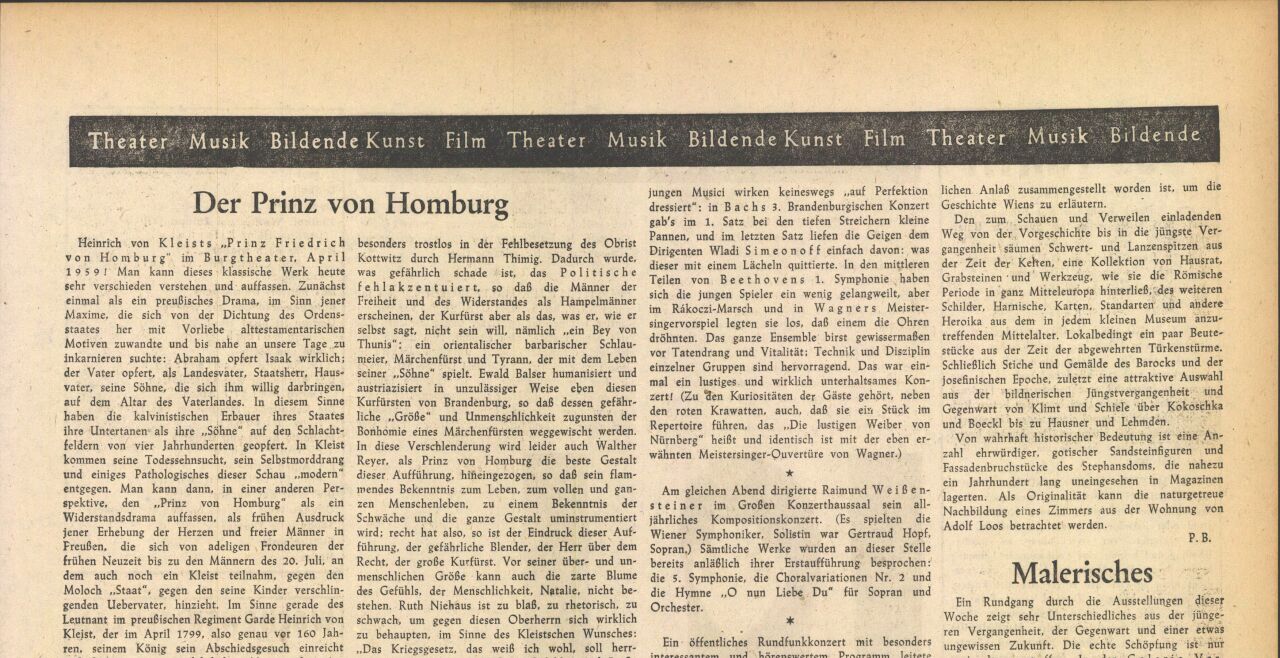
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Der Prinz von Homburg
Heinrich von Kleists „Prinz Friedrich von Homburg” im Burg theater, April 1959 1 Man kann dieses klassische Werk heute sehr verschieden verstehen und auffassen. Zunächst einmal als ein preußisches Drama, im Sinn jener Maxime, die sich von der Dichtung des Ordensstaates her mit Vorliebe alttestamentarischen Motiven zuwandte und bis nahe an unsere Tage zu inkarnieren suchte: Abraham opfert Isaak wirklich; der Vater opfert, als Landesvater, Staatsherr, Hausvater, seine Söhne, die sich ihm willig darbringen, auf dem Altar des Vaterlandes. In diesem Sinne haben die kalvinistischen Erbauer ihres Staates ihre Untertanen als ihre „Söhne” auf den Schlachtfeldern von vier Jahrhunderten geopfert. In Kleist kommen seine Todessehnsucht, sein Selbstmorddrang und einiges Pathologisches dieser Schau „modern” entgegen. Man kann dann, in einer anderen Perspektive, den „Prinz von Homburg” als ein Widerstandsdrama auffassen, als frühen Ausdruck jener Erhebung der Herzen und freier Männer in Preußen, die sich von adeligen Frondeuren der frühen Neuzeit bis zu den Männern des 20. Juli, an dem auch noch ein Kleist teilnahm, gegen den Moloch „Staat”, gegen den seine Kinder verschlingenden Uebervater, hinzieht. Im Sinne gerade des Leutnant im preußischen Regiment Garde Heinrich von Kleist, der im April 1799, also genau vor 160 Jahren, seinem König sein Abschiedsgesuch einreicht und dies in einem ausführlichen Memorandum (an seihen früheren Lehrer Martini) begründet: Der „sklavische” Exerzierdienst widere ihn an, er sei dazu ständig im Ungewissen, ob er als Mensch oder als Offizier handeln dürfe, und halte es „bei dem jetzigen Zustand der Armeen” für unmöglich, die Pflichten der Menschlichkeit mit denen , eines Offiziers zu vereinigen. Kleist hielt da „die moralische Ausbildung seiner selbst” im Soldatenstande für unmöglich. Man kann, zum dritten, den Prinz von Homburg als eine tiefenpsychologische Tragödie verstehen, wobei Kleistens Schwestermotiv, sein offen einbekanntes Verlangen nach Tod und Zeugung mit „innigster Innigkeit”, durch die zwiefache Hingabe an den tötenden Vater, den Kurfürsten, und Prinzessin .Natalie befriedigt wird.
In Wien ist anderes geschehen. Das Preußische ging in einer weichen, sentimentalischen Art unter, besonders trostlos in der Fehlbesetzung des Obrist Kottwitz durch Hermann Thimig. Dadurch wurde, was gefährlich schade ist, das Politische fehlakzentuiert, so daß die Männer der Freiheit und des Widerstandes als Hampelmänner erscheinen, der Kurfürst aber als das, was er, wie er selbst sagt, nicht sein will, nämlich „ein Bey von Thunis”: ein orientalischer barbarischer Schlaumeier, Märchenfürst und Tyrann, der mit dem Leben seiner „Söhne” spielt. Ewald Baiser humanisiert und austriazisiert in unzulässiger Weise eben diesen Kurfürsten von Brandenburg, so daß dessen gefährliche „Größe” und Unmenschlichkeit zugunsten der Bonhomie eines Märchenfürsten weggewischt werden. In diese Verschlenderung wird leider auch Walther Reyer, als Prinz von Homburg die beste Gestalt dieser Aufführung, hineingezogen, so daß sein flammendes Bekenntnis zum Leben, zum vollen und ganzen Menschenleben, zu einem Bekenntnis der Schwäche und die ganze Gestalt uminstrumentiert wird; recht hat also, so ist der Eindruck dieser Aufführung, der gefährliche Blender, der Herr über dem Recht, der große Kurfürst. Vor seiner über- und unmenschlichen Größe kann auch die zarte Blume des Gefühls, der Menschlichkeit, Natalie, nicht bestehen. Ruth Niehaus ist zu blaß, zu rhetorisch, zu schwach, um gegen diesen Oberherrn sich wirklich zu behaupten, im Sinne des Kleistschen Wunsches: „Das Kriegsgesetz, das weiß ich wohl, soll herrschen, jedoch die lieblichen Gefühle auch.” So siegt das Kriegsgesetz, das Schmettern der Fahnen und Trompeten, es entsteht, wohl ungewollt, eine eigentümliche Mythisierung des Unwesens eines Einmannstaates und seiner permanenten Kriegswelt, geht es doch gleich weiter zu neuer Schlacht, am Ende des Stückes. Untergang des innersten Motivs des Dichters, der „mit ruhiger und fester Hand zum ersten- und letztenmal im Ernst eine Waffe gebrauchte”, als er sich erschoß. Am guten Willen aller beteiligten Schauspieler, die sich der Regie Adolf Rotts stellten, ist nicht zu zweifeln. Liegt es an der verwaschenen, verworrenen Atmosphäre, in der unsere Oeffentlichkeit und damit unser Publikum heute leben, daß dieses Werk so merkwürdig mißverstanden auf unsere Bühne kommt, ins Burgtheater, im April 1959?
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!