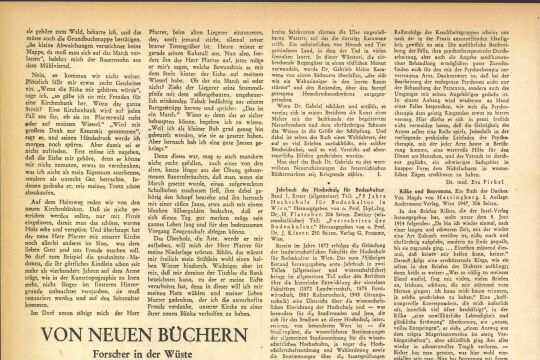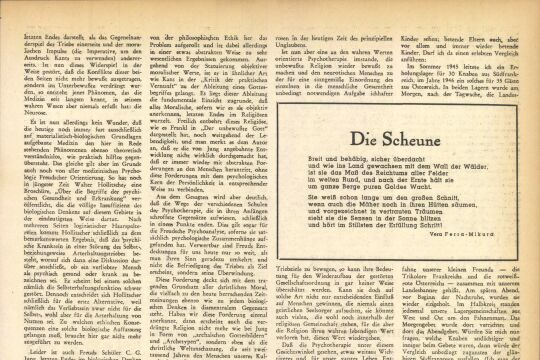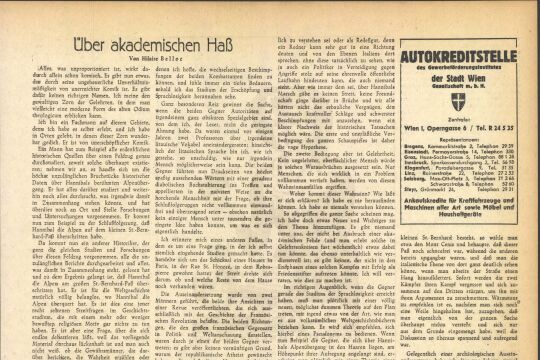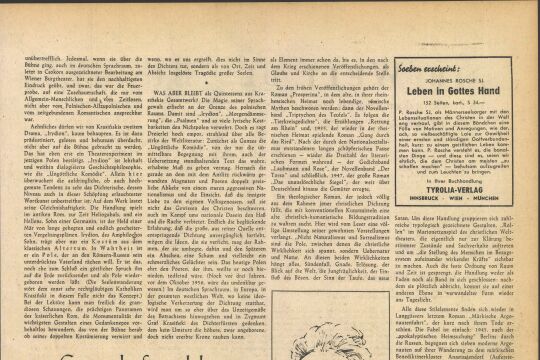Drei Brüder und ein Sommer in Schweden
Der Schauplatz ist ein wie aus dem Reisekatalog „Schönes Skandinavien“ entsprungenes Holzhaus, einsam gelegen an einem See, irgendwo in der schwedischen Provinz. Drei Brüder treffen sich hier, um den letzten Wunsch ihrer Mutter zu erfüllen: Ihre Asche in den See zu streuen.
Der Schauplatz ist ein wie aus dem Reisekatalog „Schönes Skandinavien“ entsprungenes Holzhaus, einsam gelegen an einem See, irgendwo in der schwedischen Provinz. Drei Brüder treffen sich hier, um den letzten Wunsch ihrer Mutter zu erfüllen: Ihre Asche in den See zu streuen.
I n seiner Heimat Schweden ist der 1976 geborene Alex Schulman eine auf vielen Kanälen hoch präsente mediale Figur. Seiner Mutter widmete er ein autobiografisches Werk, das 2017 zum schwedischen Buch des Jahres gekürt wurde. Und mit seinem sofort in über 30 Länder verkauften Romandebüt „Die Überlebenden“ werden, geschürt von vergleichsweise großen Marketinganstrengungen, allenthalben Bestsellerhoffnungen geweckt. Dessen ungeachtet ist Schulmans Roman kein auf schnelle Konsumierbarkeit hin geschriebenes Buch. Es unterläuft geschickt Lesererwartungen und erzählt eine Familiengeschichte von hoher Ambivalenz.
Schauplatz ist ein wie aus dem Reisekatalog „Schönes Skandinavien“ entsprungenes Holzhaus, einsam gelegen an einem See, irgendwo in der schwedischen Provinz. Dort verbrachten die Brüder Nils, Benjamin und Pierre zusammen mit ihren Eltern einst die Sommermonate, und dorthin kehren die drei zwanzig Jahre später zurück, um den letzten Wunsch ihrer Mutter zu erfüllen: Ihre Asche soll fernab des Grabes ihres Mannes in den See gestreut werden. Die Brüder kommen dem nach, entreißen dem auf seine Vorschriften pochenden Bestatter die Urne und fahren zurück in ihre Kindheit.
Die von Schulman gewählte Erzählkonstruktion lässt zwei Stränge aufeinander zulaufen. Da ist die Gegenwart der Brüder, inzwischen alle um die dreißig Jahre alt, eine Gegenwart mit rabiat ausgetragenen Konflikten, die so eskalieren, dass der mittlere Bruder Benjamin um Mitternacht gezwungen ist, die Polizei zu rufen, um Mord und Totschlag zu verhindern. Von da an läuft die Geschichte rückwärts bis hin zu einem Kindheitssommer, als die Brüder sieben, neun und dreizehn Jahre alt waren. Es sind Wochen voller familiärer Verwicklungen und Spannungen. Vollkommener Urlaubsfrieden herrscht, so lieblich der See sich auch ausbreiten mag, selten. Die Brüder konkurrieren miteinander, quälen sich gegenseitig und kommen doch voneinander nicht los. Von den Eltern dürfen sie kaum Hilfe erwarten; diese interessieren sich nur oberflächlich für ihre Söhne, pflegen ein pädagogisches Laisser-faire, neigen zu cholerischen Ausbrüchen und sind zufrieden, wenn sie, versorgt mit reichlich Alkohol, aufs Wasser schauen und in die Sonne blinzeln dürfen. Vor diesem Hintergrund einer permanenten Familienanspannung werden Konflikte nicht offen ausgetragen. (Ver-)Schweigen gehört zu den Selbstverständlichkeiten des Alltags, und erst spät erkennt Benjamin, dass es dabei nicht bleiben kann: „Er muss mit seinen Brüdern über die Dingesprechen, an die sie seit zwanzig Jahren nicht gerührt haben.“
Welch gewaltsames Potenzial in den Brüdern schlummert, zeigt sich nicht nur in der blutigen Eingangsszene, sondern auch in den unterschwellig bedrohlichen Kindheitsmomenten, die der Roman heraufbeschwört. Wenn die willkürlich strafende Mutter ihre Söhne in einen düsteren „Erdkeller“ verbannt, wenn die Brüder einen lebenden Barsch in die heiße Pfanne werfen oder liebevoll gemeinte Gesten – das Pflücken eines Blumenstraußes für die Mutter – keine Beachtung finden, dann sind das Störelemente, die der Seeszenerie jedes Idyll austreiben. Und dann ist da dieses eine große Sommergeschehen, dieses Unglück, an das sich keiner der Beteiligten so recht erinnern mag. „Was ist damals passiert?“, heißt es lapidar, damals, als die Kinder in eine Umspannstation eindringen, ohne sich der Gefahr bewusst zu sein. Benjamin verletzt sich schwer, und Molly, der Hund der Mutter, ist dabei – so scheint es zumindest – zu Tode gekommen. Ob sich die Erinnerung an diesen Schock freilich im Lauf der Jahre verwischt oder nur die Maschine der Verdrängung ganze Arbeit geleistet hat, das bleibt lange im Dunkeln und lässt erst auf den letzten Romanseiten neue Deutungen zu, – ohne dass sich freilich endgültige Klarheit darüber einstellen würde, was wirklich in der Umspannstation geschah und welche Traumata daraus resultierten. Man mag darüber streiten, ob Alex Schulman mit dieser fast magischen Schlusspointe des Effektes wegen den Bogen womöglich überspannt, doch der nachhallenden Wirkung seines Debüts tut das keinen Abbruch. Seine Figuren bewahren bis zuletzt eine faszinierende Mehrdeutigkeit; keine von ihnen lässt sich auf einem Gut-Böse-Schema eindeutig zuordnen. Und nicht zuletzt haben sie alle daran zu tragen, dass etliches von dem, was in der Kindheit geschah, im Nachhinein nichts von seiner Kraft verliert, ja vielleicht umso stärker nachbebt, je mehr Jahre ins Land gehen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!