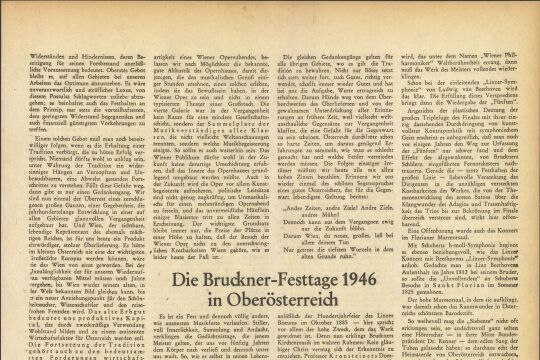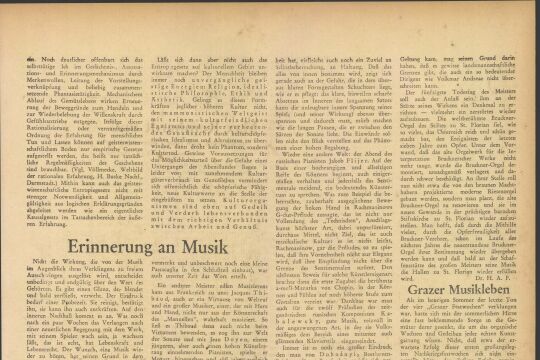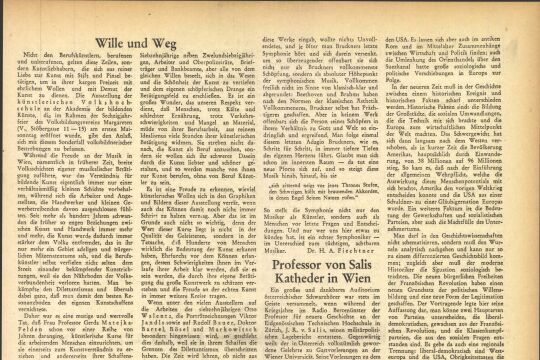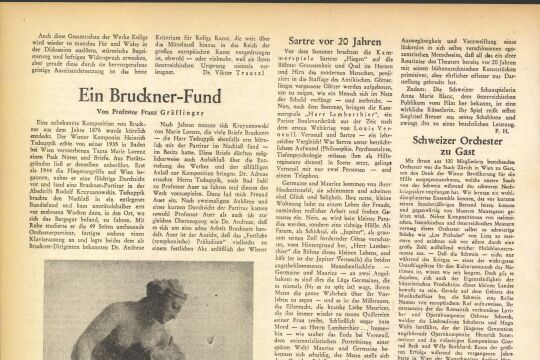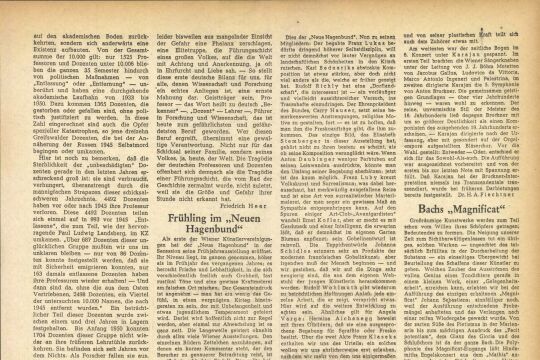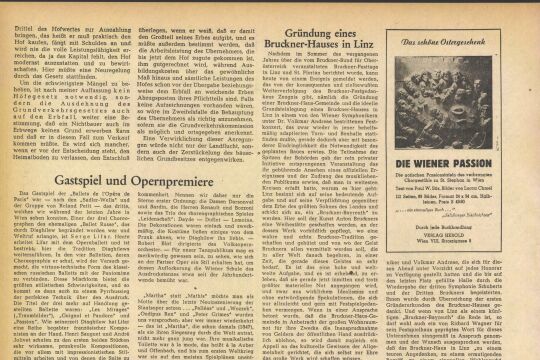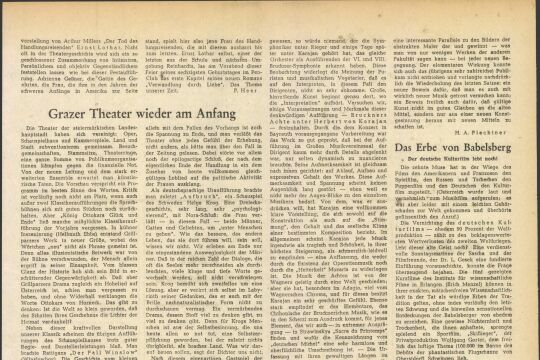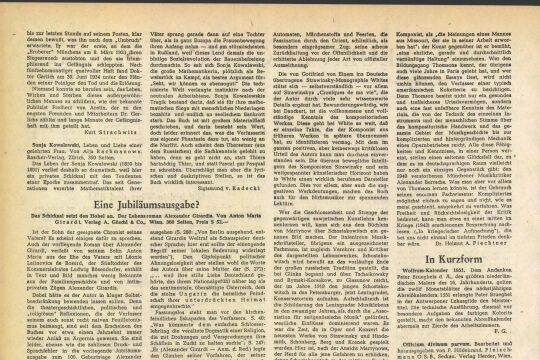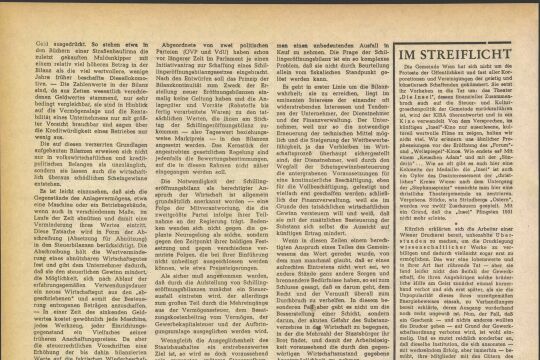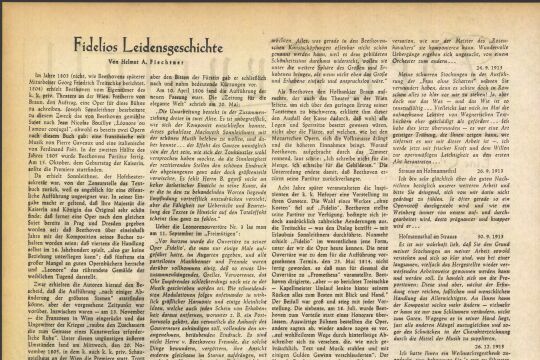War Anton Bruckner Wagnerianer?
Der Nicht-Wagnerianer Bruckner ist dennoch das Genie, das Richard Wagner ersehnte, wenn er ausrief: „Kinder, schafft Neues!“
Der Nicht-Wagnerianer Bruckner ist dennoch das Genie, das Richard Wagner ersehnte, wenn er ausrief: „Kinder, schafft Neues!“
Diese Frage im 50. Todesjahr des Meisters aufzuwerfen, scheint absurd zu sein und doch ist sie es nicht. Bekam ich da, offenbar auf Grund meiner Gedenkrede anläßlich der Festversamrrrlung 'bei den Bruckner-Festtagen in Linz, folgende Zeilen: „Aber, schämen Sie sich! Mit Bruckner Geschäfte zu machen! Sie wissen ganz genau, was ihm Wahnfried war!“
Anstatt sich zu freuen, daß wenigstens einer der Zeitgenossen Ridiard Wagners, dessen verzweifelten Ruf an Seine Nachahmer: „Kinder, schafft Neues“ von sich aus erfüllt hat, spielen diese fossilen Wagnerianer die Beleidigten, wenn man es wagt, endlich einmal Bruckners volle Souveränität als Musiker festzustellen, denn es ist noch gar nicht so lange her, daß man in Nachschlagewerken den Meister als Wagner-Epigonen stempeln zu müssen glaubte. Es ist daher durchaus zeitgemäß, obige Frage aufzuwerfen und zu beantworten.
Ich verehre Friedrich Nietzsche als einen der größten Künstler als Beherrscher der deutschen Sprache, dessen glänzende, künstlerische Formulierungen ich sogar gelegentlich zitiere, doch würde ich es auf das ent-sdiiedenste ablehnen, als Anhänger seiner Philosophie, als „Nietzscheaner“ zu gelten. Genau dasselbe gilt im Falle Bruckner für Wagner!
Bruckner verehrte und bewunderte Richard Wagner als Musiker und Vorkämpfer musikalischen Fortschrittes und nannte ihn „Meister aller Meister“ und doch war er nichts weniger als „Wagnerianer“ im eigentlichen Sinne, das heißt ein Mann, der seine Ansicht vom Ende der absoluten Musik teilte und seine Thesen über das „Gesamtkunstwerk“, das allein zukunftsweisend sei, geteilt hätte. Ganz abgesehen davon, daß Bruckner ein Verständnis für die dramatischen Vorgänge etwa im „Ring der Nibelungen“ oder gar für die demselben zugrunde liegende Sdiopenhauersche Philosophie gehabt hätte. Man hat die Musik als „die Kunst des Vergessens“ bezeichnet und für Bruckner war sie es gewiß, denn wenn er von ihr umfangen war, hörte für ihn jedes Denken, jede intellektuelle Regung auf. Er war eben „Nur-Musiker“.
Die Bühnenhandlung berührte ihn kaum oder wurde von ihm mißverstanden. So meinte er bei einer „Tannhäuser“-Aufführung in Bayreuth einmal bei der Romerzählung: „Warum hat er (der Papst) ihn denn not begnadigt?“ Zwei weitere charakteristische Aussprüche beweisen zur Genüge, wie wenig Bruckner Wagnerianer war. Als Brunhilde, von Siegfried aus dem Zauberschlaf erweckt, den Preisgesang „Heil dir, Sonne, Heil dir, Licht!“ anstimmt, stößt Bruckner den neben ihm sitzenden Schüler Felix Mottl an und raunt ihm zu: „Felixl, was schreit denn dö Materna a so!“ und als der Meister einst im Kreise orthodoxer Wagnerianer gefragt wurde, ob er nicht auch eine Oper sdireiben wolle, meinte er, das könne schon sein, aber es müßte eine Oper sein wie „Tannhäuser“, wo eine sagt: „Geh' sing ma ans und er singt dann ans!“ Seine Anhänger erbleichten, denn das war doch die vollständige Ablehnung des Wagnerschen Musikdramas und das Bekenntnis zur geschlossenen musikalischen Form.
Schon die geistigen Hintergründe des Schaffens beider Großen sind so verschiedenartig, daß ihre Kunst eher gegensätzlich als innerlich verwandt sein kann. Wagner kam vom Theater her und strebte willens-mäßig eine Erneuerung der griechischen. Tragödie an, die „Geburt der Tragödie aus der Musik“, wie Nietzsche sagt. Bruckners musikalisches Urerlebnis aber war der Orgelklang von St. Florian rnd das uralte Gesamtkunstwerk der katho'ischen Liturgie und seine Sendung war, um Nietzsches Wort zu variieren, die Geburt der Musik aus der Gottesidee. Seherisch drück: dies Maurice v. Stern in dem Vers aus.
„Wenn uns zu irdischem Applaus"
Großes ein anderer Großer' beut, Schütte nur deine Sonne aus, Größer noch ist dein Gottesh.tus Als |ener Tempel zu Bayreuth . ..“ Da, wie aus dem Gesagten hervorgeht, geistige Vergleichspunkte völlig wegfailen, verbleiben als solche lediglidi die materiellen Erscheinungsformen der Musik, vor allem Harmonik und Instrumentation. Und doch ist es ein Geistiges, das Bruckner durch seine erste Bekanntsdtaft mit der Kunst Wagners in Linz geschenkt wurde, nämlich die Befreiung seines musika-lisdien Ich aus der Tradition und den allzu strengen Sdiulfesseln der Sechterschen Theorien.
Aber das ersah Bruckner nicht nur aus Wagners „Tannhäuser“-Partitur 1863, sondern auch aus dem Studium der „Faust“-Symphonie von Franz Liszt und der ersten Bekanntschaft mit Berliozscher Musik, sondern vor allem auch aus dem Erleben und dem Studium der „Neunten“ Beethovens und anderer seiner die Sechtersdien Theorien weit überflügelnden Werke. Was Bruckner bisher nur als Improvisator an der Orgel auszusprechen gewagt hatte, das sah er bei den genannten Meistern schwarz auf weiß fixiert und nun erst getraute auch er sich das zu Papier zu bringen, was er längst fühlte und bisher nur der Orgel anvertraut hatte: die Aussprache seines inneren Erlebens.
Aber wie seltsam! Das erste freie Werk, das er schuf, seine Messe in d-moll enthielt keinerlei Anklänge an den „Tannhäuser“, sondern — wie ich vielfach nachgewiesen habe, und zwar sdion 1924 in der ersten Auflage meiner Bruckner-Biographie — frappierende Anklänge an Werke Wagners, die damals noch gar nicht geschrieben waren. Wenn man mit Wagner-Ohren hört, kann man im Kyrie gleich zu Beginn das Thema des „Liebestods“ aus dem „Tristan“ vernehmen, gegen Ende des Satzes die Musik beim Herabschweben der Taube im „Par-sifal“ und im Agnus leibhaftig das Speermotiv aus dem „Ring“ erscheinen sehen. All das 1864! Die bekannten „Grals-Sexten“ begegnen uns bei Bruckner bereits in einem „Tantum ergo“ aus der Florianer Zeit des Meisters und sie tauchen wieder am Ende des Adagio-Themas seiner Neunten auf. Man könnte also hier nur von Vorahnungen, aber nicht von Nachahmung Wagners sprechen. Wie aber ist so etwas möglich?
Jede Zeit hat ihren besonderen Ausdruck, wodurch die Kunst der zeitgenössischen Meister gewisse äußere Familienähnlichkeit erhalt. Ist es doch selbst Fachleuten manchmal schwer, festzustellen, ob ein weniger bekanntes Werk von Händel oder Bach oder ob ein solches von Haydn, Mozart oder dem jüngeren Beethoven stammt. Viel geringfügiger aber erscheinen die Familienähnlichkeiten etwa zwischen einem Ausschnitt aus irgendeiner Brucknerschen Symphonie und einem aus Wagners Musikdramen, wenn sie auch die hochromantische Harmonik und moderne Orchestertechnik aufweisen. In diesem Fall ist eben der geistige Gegensatz das Maßgebende.
Wurzeln in der Hochromantik
Die Harmonie Wagners und Bruckners fußt in der zeitgenössischen Hochromantik, die das Verbindende der ganzen „neudeutschen Schule“ ist und vor Wagner schon durch Franz Liszt zur Höhe geführt wurde. Bei Bruckner ist diese Harmonik übrigens durch die mehr kontrapunktische, lineare Stimmenführung herber als bei den genannten Meistern und entbehrt vor allem jeder weichlichen erotischen Sinnlichkeit. Schon mit seiner e-moll-Messe hat Bruckner in den Misereresätzen die Wagnersche Harmonik weit überholt und Klangballungen geschrieben, die später erst wieder bei Richard Strauß vorkommen. Als Bruckners Jünger ihn bei der Neuentdeckung der I. Symphonie aufmerksam machten, daß im Adagio „Parsifal“-Klänge (1865) vorkämen, freute er sich darüber und fand es „köstlich“, schon damals diese viel später entstandene Musik erahnt zu haben.
Das einzige absichtliche Zitat, eine Stelle aus dem „Schlafzauber der Walküre“, das Bruckner gegen Ende des Adagios seiner „Wagner-Symphonie“ einfügte, sozusagen als Huldigung für Wagner, dem er das Werk widmete, wurde bei der Umarbeitung dieses nie aufgeführten Werkes wieder entfernt und es verblieben nur wenige Takte davon in der späteren III. Symphonie übrig. Der Seherblick Wagners mußte aus dieser noch unvollkommenen Fassung des Werkes die Unrichtigkeit seiner These vom Ende der absoluten Musik erkannt und die Urständigkeit des Brucknerschen Genius erschaut haben.
Bruckner lag jede Reflexion, jede Intellektualisierung der Musik fern und es ist sogar zu bezweifeln, ob der der IV. Symphonie beigefügte Ausdruck „romantische“ von ihm selbst stammt. Sicher ist, daß die allererste Fassung des Werkes von ihm nur als „Symphonie Es-dur“ bezeichnet worden ist und offenbar, als man den Waldcharakter des Werkes entdeckt hatte, der Meister dann das ursprüngliche Scherzo durch ein „Jagd“-Scherzo ersetzte. Versuche einer programmatischen Auslegung des Werkes scheiterten schließlich mit der Erklärung des Meisters: „Beim Finale, ja da waß i wirkli nimmer, was i mir dabei denkt hab.“ Bruckners musikalische Eingebungen waren eben vollständig unbewußt und absolut und das unterscheidet ihn nicht nur von Wagner, sondern auch von der stark willensbedingten Art Beethovens grundsätzlich. Bruckner hat • also nicht nur das Musikdrama, sondern auch die „symphonische Dichtung“ als Ausdruck seiner Zeit nicht akzeptiert. „Nur als Reiner konnte er“, um mit Nietzsche zu sprechen, „die Reinheit der Musik wiedergewinnen.“
Neben der Harmonik ist es noch die Instrumentation, welche die Meister einer Zeitepoche verbindet. Da war es vor allem das Streichertremolo, das man Bruckner als Wagnerianismus anlastete, obwohl es schon im Mittelalter durch Monteverdi als Mittel dramatischer Effekte angewendet wurde und auch von Wagner vorherrschend als solches gebraucht wird, während es bei Bruckner meist als der ruhig flimmernde Hintergrund seiner eigenartig in dynamischer Steigerungsentwicklung sich zur „unendlichen Melodie“ ausspinnenden symphonischen Gedanken dient, der in absolutem Gegensatz zu der gedanklich bedingten Zeitmotivik Wagners steht. Bruckners Instrumentation, deren Schwerpunkt überwiegend im Streicherklang liegt, steht daher der Orchestration der Klassiker näher als der seinerzeitigen Moderne. Lediglich die Klangfarbe der Tuben hat er von Wagner in die Symphonie übernommen und den Blechbläserklang ausgestaltet. Aber selbst einer der prominentesten Wagnerianer, Franz Schalk, stellte fest, daß Bruckners Blechbläserklang sich von dem Wagners grundlegend unterscheidet, was er auf die konstruktive Stimmenführung auf Grund der Sechterschen Fundamentaltheorie zurückzuführen glaubte. Das Sakrale Bruckners tritt hier gegenüber dem Theatralen Wagners ganz offen in Erscheinung und ist hier eben wieder mehr auf die geistige Haltung als' auf die äußere Erscheinungsform der Instrumentation zurückzuführen.
Kaleidoskopartige Mischfarben
Die in der Musikgeschichte einzig dastehende Tatsache, daß das Werk eines Genies erst im vierten Jahrzehnt nach seinem Tode der Öffentlichkeit in seiner Originalgestalt geboten werden kann, löst auch die letzten Rätsel, wieso man Bruckner selbst nur als Instrumentator von Wagner abhängig bezeichnen konnte. Einige seiner Hauptwerke, die seit Jahrzehnten der Öffentlichkeit nur in fremder Bearbeitung im Sinne des damals geltenden Wagnerschen Klangideals der kaleidoskopartigen Mischfarben zugänglich waren, erklingen heute frei von fremden Zutaten in ihrer dem geistigen Gehalt adäquaten originalen Instrumentation, die auf des Meisters Orgelerlebnis zurückgeht, den Orgelklang bewußt in das Symphonieorchester einbaut, was man zu seiner Zeit als „Mangel“ annehmen zu müssen glaubte. Bruckners einfache Farbengebung steht in größtem Gegensatz zu der Kompliziertheit der gesamten neudeutschen Schule bis hinauf zu Richard Strauß.
Die eigene Welt des Genies schuf sich eben auch den ihm eigenen Ausdruck in der Instrumentation. Und damit ist der Nicht-Wagnerianer Bruckner doch das Genie, das Wagner ersehnt, wenn er ausrief: „Kinder, schafft Neues!“ Und so freuen wir uns, „zwei so tüchtige Kerle“ wie Wagner und Bruckner in einer Generation empfangen zu haben und Bruckner als den einzig Starken erkennen zu können, der auch dem „Zauberer von Bayreuth“ gegenüber stark geblieben ist.