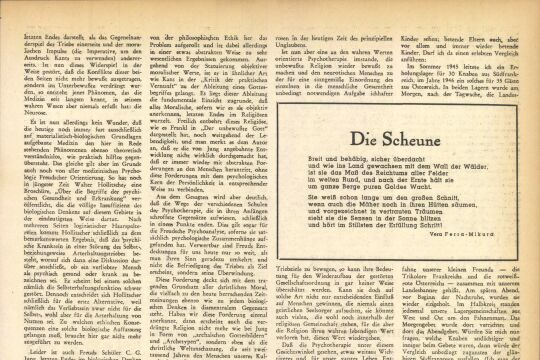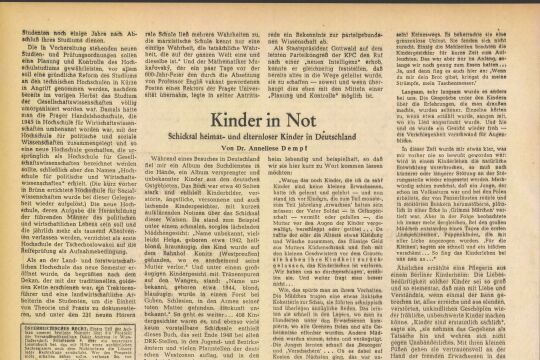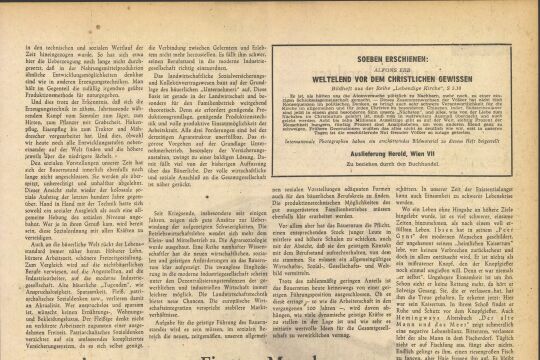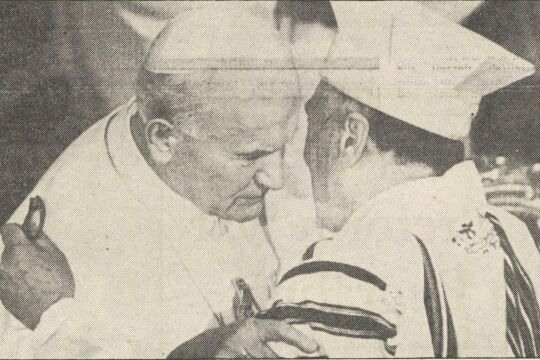Viele jüdische Kinder wurden in den Niederlanden im Krieg von Nichtjuden adoptiert. Einige erfahren von ihrer Herkunft erst im Alter – oder wollen es erst dann erfahren.
Eine Ahnung war da immer gewesen, unterschwellig, aber latent. Seit er ein Jugendlicher war, hatte Ron de Leeuw (Name geändert) die Vermutung, eigentlich Jude zu sein. Von seinen Pflegeeltern, die ihn im Alter von drei Jahren adoptiert hatten, erfuhr er nicht mehr, als dass er keine Familie mehr habe; seine Vermutung sei daher so abwegig nicht. Erst als er nach ihrem Umzug in ein Pflegeheim das Haus ausräumte, fand er in einer Tasche die Wahrheit: eine Arbeitsgenehmigung mit Foto seiner Mutter und eine Identitätskarte seines Vaters. Beide waren Juden, die die deutsche Besatzung nicht überlebten. Ron de Leeuw, der mit über 50 Jahren zum ersten Mal ein Bild von seinen Eltern gesehen hatte, machte sich auf die Suche nach Familienangehörigen – und fand sie in seiner Stadt, in der Nachbarstraße.
„Wer normal geblieben ist, ist gestört“
Eine solche Entdeckung stellt alles auf den Kopf – und ist doch alles andere als ein Einzelfall, zumal in den Niederlanden, wo es vor der Schoa selbst in kleinen Dörfern jüdische Gemeinden gab. Binyomin Jacobs, orthodoxer Oberrabbiner des Landes, geht davon aus, dass es im Land noch Hunderte Personen gibt, die als Kind von nichtjüdischen Familien angenommen wurden und davon bis heute nichts wissen. Diese Menschen zu finden, ist ihm ein Anliegen – aus Respekt gegenüber ihren ermordeten Eltern. Seit 1975 ist Jacobs Rabbiner im Sinai Centrum, der einzigen jüdischen psychiatrischen Einrichtung Westeuropas, wo er mit dem Thema in Berührung kam – und mit zahlreichen Betroffenen, die dort behandelt werden. „Wer den Krieg überlebt hat und normal geblieben ist, ist gestört“ – hinter der süffisanten Bemerkung ist es Jacobs bitter ernst. Die Entdeckung der jüdischen Wurzeln im hohen Alter stellt oft das gesamte bisherige Leben in Frage, und die Folgen sind unabsehbar. „Zudem fühlen sich viele ihren leiblichen Eltern gegenüber als Verräter.“ Behutsamkeit ist daher unabdingbar: „Es ist nicht so einfach, dass die Wahrheit immer eine Erlösung bedeutet. Im Gegenteil.“
Wie komplex dieses Verhältnis ist, weiß Louk de Liever. Der 69-Jährige gehörte zu einer Gruppe von 51 Kindern, die im September 1944 mit dem letzten Gefangenenzug aus dem Durchgangslager Westerbork nach Bergen-Belsen und später nach Theresienstadt transportiert wurde. Sie galten als „unbekannte Kinder“, die bei nichtjüdischen Familien untergebracht und verraten worden waren. Im Mai 1945 wurden sie von der Roten Armee befreit. Die Gruppe ist heute in der ganzen Welt verstreut, doch es besteht Kontakt untereinander, seit vor zehn Jahren ein Buch über sie erschien und ein Dokumentarfilm gedreht wurde.
Unter ihnen, erzählt er, gebe es alle denkbaren Varianten von Schicksalen untergetauchter Kinder: viele blieben bei ihren Pflegefamilien, da ihre Eltern ermordet waren. Bei anderen stritten sich erweiterte Familienangehörige mit den Pflegeeltern um die Kinder, was nicht selten vor Gericht endete. Wer noch einen Elternteil hatte, kehrte zu diesem zurück. Louk de Liever selbst gehörte zu den wenigen, deren Eltern beide noch lebten. „Aber sie hatten im Krieg derart Schaden gelitten, dass ihr Band zu mir kaputt war. Die Beziehung ist nie wieder geworden, was sie sein sollte.“ De Liever war zwei Jahre alt, als seine Eltern ihn aus dem ostniederländischen Nijkerk zu Bekannten nach Amsterdam brachten. Dreieinhalb Jahre später kehrte er zurück. Seine Großeltern erkannten ihn, sein Vater anfangs nicht. Seine Mutter glaubte erst ans Überleben, als er die Narbe auf seinem großen Zeh zeigte. Während die Beziehung mit den eigenen Eltern Zeit ihres Lebens mühsam blieb, hat Louk de Liever engen Kontakt mit seiner Pflegefamilie. „Das ist mir sehr wichtig. Nicht aus Verpflichtung, sondern aus Gefühl heraus.“
Der Krieg bleibt stecken wie ein Kaktus
Wie verschlungen die Wege der Überlebenden auch nach Jahrzehnten sein können, zeigt das Schicksal von Joop Snoek (Name geändert). Als er in fortgeschrittenem Alter von seinen jüdischen Ursprüngen erfuhr, begab er sich auf die Suche nach der eigenen Vergangenheit: zusätzlich zum Namen seiner Pflegefamilie, den er noch immer trug, nahm er den seiner leiblichen Eltern wieder an. Er trat mit der jüdischen Gemeinde in Kontakt, vertiefte sich ins Judentum, widmete seine Zeit Gedenkveranstaltungen im In und Ausland. Eine Sisyphusaufgabe, meint Louk de Liever: „Er hat sich auf eine Aufholjagd begeben, nach etwas, das sich nicht aufholen lässt.“ Dass der Spagat zum bisherigen Leben mit meist nichtjüdischen Partnern zur Herausforderung wird, liegt nahe. „Oft bekommen auch deren Kinder große Probleme.“
Dass sich die Entdeckung der eigenen Biografie erst in einem gewissen Alter einstellt, ist typisch. Die meisten sind im Rentenalter oder kurz davor und damit in einem Lebensabschnitt, der andere Prioritäten setzt als Arbeit und Verdienst. Zudem schiebt die Psyche das Leben in der so genannten Illegalität oft auf eine ziemlich lange Bank. „Untertauchen dringt als Kind nicht zu dir durch. Erst später wirst du dir der Dimensionen bewusst“¸ weiß Erna Houtkooper. In der Besatzungszeit in Ermelo untergetaucht, ist sie heute Sekretärin der Vereinigung Jüdische Kriegs Kinder (JOK). Diese entstand auf dem ersten großen Treffen untergetauchter Kinder Mitte der 1990er Jahre in Amsterdam. Verdrängungsprozesse sieht Erna Houtkooper nicht nur bei den damaligen Kindern. Auch die niederländische Gesellschaft habe lange gebraucht, sich diesem Thema zu stellen. „Es wurde totgeschwiegen, die Leute hatten selbst mit Mühe den Krieg überlebt und sahen sich als Opfer, da wartete niemand auf Geschichten jüdischer Überlebender.“
Die relative Offenheit, die in den 90er Jahren gegenüber solchen Berichten bestanden habe, wähnt Houtkooper auf dem Rückzug. „Damals war die Einstellung gegenüber Israel positiver.“ Heute dagegen nehmen antiisraelische und antijüdische Tendenzen in den Niederlanden wieder zu. Dadurch finden sich die Schicksale untergetauchter Kinder weniger in der Öffentlichkeit wieder. Wie das Jüdische Wohlfahrtswerk JMW eine Gesprächsgruppe für Betroffene vorstellt, spricht Bände: „Selbst gute Freunde schauen manchmal seltsam, wenn du über deinen Hintergrund redest. Doch in den Kindern von damals bleibt der Krieg stecken wie ein Kaktus.”
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!