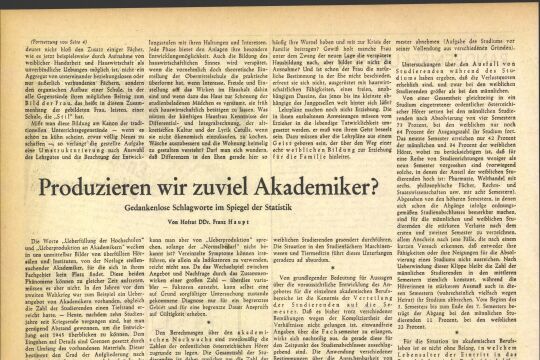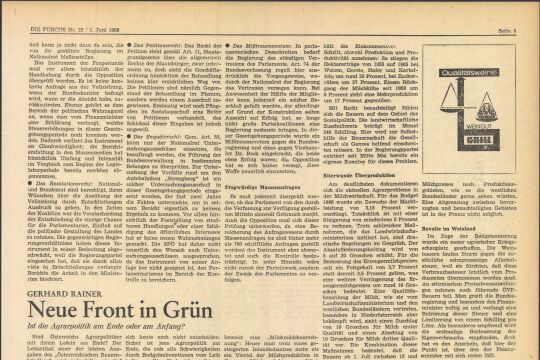Krankes Gesundheitssystem?
Nicht Zugangsbeschränkungen fürs Medizinstudium helfen weiter, sondern nur eine sinnvolle Ausbildungsreform.
Nicht Zugangsbeschränkungen fürs Medizinstudium helfen weiter, sondern nur eine sinnvolle Ausbildungsreform.
Es scheint, als ob die Diskussion um das Gesundheitssystem auf dem Rücken der Schwächsten, also der Patienten und vor allem des Mediziner-Nachwuchses, ausgetragen wird. Das System sei unbezahlbar, die Jobs seien längst weg. Zu viele Jungärzte, zuwenig Platz. Wir kennen das Bild vom Taxifahrer Dr. med.
Die Hauptakteure des medialen Showdowns sind einerseits der Gesundheitssprecher der ÖVP, Erwin Rasinger, andererseits die Ärztekammer. Beide sind fest davon überzeugt, daß die so hohe Anzahl an Studierenden für die komplette Misere verantwortlich ist. Daher muß logischerweise die Konsequenz gezogen werden: Verringerung der Studierendenzahl. Man nimmt an, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen zu haben. Weniger Studierende bedeuten bessere Ausbildung und mehr Jobs. Rasinger untermauert seine Forderung nach einem beschränktem Zugang zum Medizinstudium halbjährlich im Rahmen einer Pressekonferenz, vorzüglich kurz vor Inskriptionsbeginn, mit neuen Horrorzahlen. Acht Jahre Durchschnittsstudiendauer, drei Jahre Wartezeit auf den Turnus, dann Turnus bzw. Facharztausbildung. Viele sind bei Ende ihrer Ausbildung schon an die 30 Jahre alt. Wenn man dann das Glück hat, einen Kassenvertrag zu ergattern, beginnt die Existenzgründung mit Investitionen in Ordination etc. Vielleicht kann man nach jahrelangem Schuften schuldenfrei in die Pension gehen.
Schön langsam drängt sich der Gedanke auf, daß einzig und allein die Reduktion der Studierendenzahlen die genannten Probleme nicht lösen können wird. Daß sich die Ärztekammer allerdings auf diese Forderung versteift, ohne gleichzeitig ein innovatives Ausbildungskonzept vorzulegen, ist verständlich. Gerade die Kammerfunktionäre sind Meister im Verteidigen der eigenen Macht. Schon verständlich, daß sich ein Primararzt vor den arbeitslosen Jungmedizinern fürchtet, könnten sie ihm doch die Kassenordination gefährden, in der es sich so nett dazuverdienen läßt. Wenn die Horde der Jungen Jobs und Reformen fordert, rückt man lieber zusammen, verteidigt eisern die erarbeiteten bzw. ererbten Privilegien und fordert die Reduktion der Zahlen derer, die einem vielleicht gefährlich werden könnten. Apropos ererbt: In Niederösterreich fällt die Vergabe von Kassenverträgen nach wie vor unter das Erbrecht, Söhne und Töchter von Medizinern werden vorgereiht. Es wäre interessant, nachzuprüfen, ob sich dieser Zustand mit dem Gleichheitsgrundsatz vereinbaren läßt.
Wie schaffen wir ein international vergleichbares Niveau, wenn wir uns fürchten, daß uns durch den EU-Beitritt die paar übrigen Jobs von Deutschen weggenommen werden? Dabei ist noch niemand auf die Idee gekommen, österreichische Jungärzte zu unterstützen, selbst nach oder während der Ausbildung für einen bestimmten Zeitraum ins Ausland zu gehen, um Erfahrungen zu sammeln.
Daß es an der Ausbildung derzeit krankt, wird von niemandem mehr bezweifelt. Das Studium ist überfrachtet mit theoretischem Faktenwissen, das von Studierenden unreflektiert bei Prüfungen reproduziert werden muß. Der erste Patientenkontakt findet im zweiten Abschnitt statt, wenn Studierende bereits durchschnittlich drei Jahre an der Universität verbracht haben. Bemerkt man bei diesem ersten Kontakt mit dem Berufsfeld, daß man sich nicht geeignet fühlt, ist es zu spät, das Studium zu wechseln. Wertvolle vergeudete Jahre! Klinische Grundfertigkeiten, die für die alltägliche Stationsarbeit im Turnus beherrscht werden müssen, können sich Studierende lediglich in spärlich vorhandenen Freifächern aneignen. Um erfolgreich das Studium abzuschließen, genügt es also, Tausende Bücherseiten punktuell auswendig zu lernen, um sie am nächsten Tag wieder zu vergessen. Ob man fähig ist, mit Patienten Kontakt aufzunehmen, der ärztlichen Rolle entsprechend zu kommunizieren, geschweige denn grundlegende Untersuchungen durchzuführen, spielt im Medizinstudium derzeit keine Rolle. Nach der Promotion sollen dann die Versäumnisse des Studiums wettgemacht werden, was allerdings zu diesem Zeitpunkt zu spät ist. Man findet sich als Jungarzt im ersten Nachtdienst plötzlich mit Situationen konfrontiert, von denen man noch nie etwas gehört oder gesehen hat.
Die Universität stellt sich nun diesem Problem. Professoren, Mittelbau und Studierende arbeiten derzeit an einer Studienreform, die genau diese Probleme beseitigen soll. Bereits in den ersten Semestern soll Studierenden das künftige Berufsfeld ohne Illusion und mit allen positiven wie negativen Seiten nahegebracht werden. Eine freie Entscheidung über das Fortsetzen eines Studiums kann nicht durch eine punktuelle theoretische Knock-Out-Prüfung erreicht werden.
Schließlich wollen wir primär gut ausgebildete Ärztinnen und Ärzte. Nur mit einer sinnvollen Ausbildungsreform können die Probleme des Systems gelöst werden. Zusätzliche Hürden in das bestehende Modell einzubauen, löst weder Probleme, noch könnte man das als Reform bezeichnen, die wir so bitter nötig haben.
Der Autor ist Kuriensprecher der Studierenden an der Medizinischen Fakulktät der Universität Wien.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!