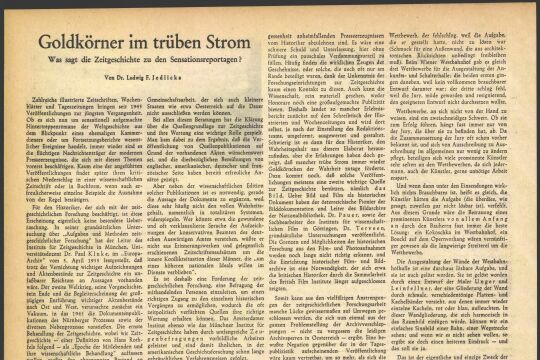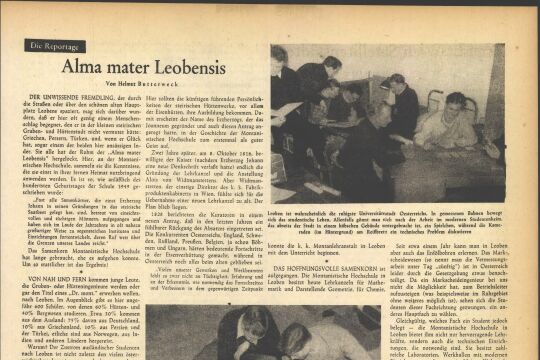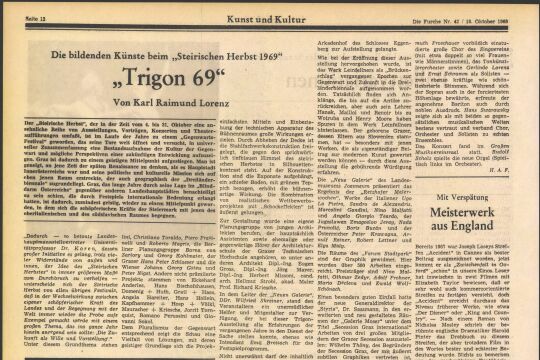Ich habe unser Museum immer so betrieben wie die Unternehmen, die ich geführt habe, also sparsam und möglichst ohne Schulden.
Es gibt einen Zusammenhang zwischen Ästhetik, Ordnung und Rationalität. Ich habe gelernt, dass eine anspruchsvoll gebaute Fabrik in den Abläufen transparent ist.
Der Kärntner Unternehmer und Kunstsammler Herbert Liaunig hat in Neuhaus/Suha bei Lavamünd ein preisgekröntes, bereits unter Denkmalschutz stehendes Museum von der Architektengruppe Querkraft errichten lassen. Auf einer Gesamtfläche von fast 8000 Quadratmetern werden in dem einzigartigen, größtenteils unterirdischen Bauwerk und in dem darüber befindlichen Skulpturenpark zum zehnjährigen Jubiläum Gemälde und Skulpturen österreichischer Künstler von 1945 bis heute ausgestellt. Viele von ihnen sind Freunde des Sammlers, der die Leitung im Jubiläumsjahr an seinen Sohn Peter übergibt. Auf die Unterstützung der öffentlichen Hand hat Herbert Liaunig immer verzichtet. Das Museum und seine Ausstellungen und Konzerte werden ausschließlich aus privaten Mitteln finanziert.
FURCHE: Ihr Museum wurde vor einem Jahrzehnt eröffnet. Sie werden die Leitung an Ihren Sohn Peter übergeben. Wie sieht Ihre Bilanz aus?
Herbert Liaunig: Wenn man selbst weit über 70 ist, dann sind zehn Jahre nicht so lang. Es ist aber ein Zeitraum, in dem man rückblickend viel gelernt hat. Als Dilettant und Liebhaber weiß man ja zunächst nicht, welche Probleme mit einem Museum verknüpft sind. Die Entwicklung war, wenn man sie in Zahlen misst, nicht unbefriedigend. Sie war sogar weit über den Erwartungen. Vor drei Jahren hat es durch die Erweiterung des Museums eine 50-prozentige Steigerung der Besucher gegeben. Die Gemeinde hat uns sogar einen zusätzlichen Parkplatz zur Verfügung gestellt. An Spitzentagen sind wir nämlich mehr als ausgelastet.
FURCHE: "Umrahmung schräg gekippt. Die Sammlung Liaunig in Bewegung" ist der Titel der Jubiläumsausstellung. Wie haben Sie diese konzipiert?
Liaunig: Wir wollten ursprünglich eine Best-of-Ausstellung präsentieren, aber bei einer solchen wird immer gewertet. Das wollten wir vermeiden, weil wir jene Künstler, die nicht dabei gewesen wären, gekränkt hätten. Wir zeigen eine Ausstellung, die ein bisschen schräg zu dem läuft, was man in Österreich gewohnt ist zu sehen. Wir zeigen nicht die bei uns immer dominant gewesene barocke, expressive Malerei, sondern wir beginnen mit der wirklich abstrakten Kunst und das geht dann bis zu den gegenständlichen Vertretern. Ein Drittel sind Abstrahierende wie Max Weiler oder Josef Mikl und der Rest sind Einzelgänger-Positionen. Insgesamt werden 101 Werke von vorwiegend bekannten, aber auch jüngeren, weniger bekannten, vorwiegend österreichischen Künstlern gezeigt.
FURCHE: Wie ist Ihre Sammlung entstanden? Waren Sie schon immer kunstbegeistert?
Liaunig: Ich habe schon von Kindheit an leidenschaftlich Briefmarken gesammelt und meine Sammlung wird jetzt erstmals auch ausgestellt. Während meiner Studienzeit in den Sechzigerjahren in Wien freundete ich mich mit Künstlern aus dem Kreis der Galerie St. Stephan an, wie Josef Mikl, Wolfgang Hollegha oder Markus Prachensky. Sie waren älter als meine Freunde Peter Pongratz, Erwin Ringel oder Kurt Kocherscheidt. Jetzt sind vor allem meine Altersgenossen dran. Für Pongratz, einen meiner ältesten Freunde, gibt es eine eigene Retrospektive.
FURCHE: Wie konnten Sie bei Ihrem harten Job als Unternehmer und Sanierer Künstlerfreundschaften pflegen und Ihrer Sammlerleidenschaft nachgehen?
Liaunig: Es war leicht für mich in den 70er-Jahren, weil ich beruflich noch nicht so beansprucht wurde. 1979 bin ich nach Kärnten übersiedelt, um die Firma Funder zu sanieren. Da sind Kontakte abgerissen, es gab allerdings neue in Kärnten wie etwa Peter Krawagna oder Hans Bischoffshausen. In dieser Zeit habe ich zu verdienen begonnen und die Freundschaften haben darunter gelitten.
FURCHE: Was haben Sie als Sanierer von der Kultur gelernt?
Liaunig: Ich würde das umgekehrt sehen: Was hat mir die Kultur für das Sanieren gebracht? Es klingt esoterisch. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Ästhetik, Ordnung und Rationalität. Ich habe meine Laufbahn beim Industriellen Herbert Turnauer begonnen und der hatte ein ausgesprochenes Faible für Architektur. Seine Fabrik hat Architekt Karl Schwanzer gebaut. Ich habe gelernt, dass eine anspruchsvoll gebaute Fabrik in den Abläufen transparent ist. Sie hat nicht nur die Besucher beeindruckt, sondern auch eine vollkommen andere Haltung der Mitarbeiter bewirkt. Es gelingt, eine einmal etablierte Ästhetik und Ordnung aufrechtzuerhalten, ohne ständig korrigieren zu müssen. Die Mitarbeiter beginnen sich selbstständig zu kümmern, entwickeln eigene Ideen und Projekte mit dem Wunsch, es möglichst gut und perfekt zu tun. Es entstehen Motivationen, die nicht leicht zu erklären sind, aber aus meiner Erfahrung weiß ich, dass ein funktioneller Bau eine ungeheure Wirkung auf die Belegschaft hat.
FURCHE: Ist heute die so oft keineswegs funktionelle Architektur nicht eines der großen Probleme unserer Zeit?
Liaunig: Es ist nicht das Versagen der Architektur, sondern der Bauherren. Die müssen die Aufgabe der Architekten genau definieren. Zweck und erforderliche funktionale Aspekte müssen in der Ausschreibung genau festgehalten werden. Es geht ja vor allem im öffentlichen Bereich bei den Großprojekten fast immer schief. Das liegt an den Bauherren wie dem Staat, der Städte, der Gemeinden oder wer immer das ist.
FURCHE: Warum waren Sie nie ein Freund von Förderungen der öffentlichen Hand?
Liaunig: Wir lassen uns nicht dreinreden. Wir sind bei unseren Programmen und bei der Gestaltung keinem Druck ausgesetzt. Es wäre wichtig, wenn wir eine bessere Verkehrsanbindung oder Hinweistafeln und Beschilderungen bekämen. Nicht einmal auf der Autobahn hat man das gemacht. Es interessiert die Politik einfach nicht, weil es bei uns für sie nichts zu ernten gibt. Weder Eröffnungsreden noch Events, um sich in Szene zu setzen. Je mehr einer Events veranstaltet, desto mehr Förderung bekommt er heute. Steuersenkungen wäre klüger als Förderungen. Die subventionierten Museen haben Aufgaben wie Dokumentation und wissenschaftliche Arbeit, die von den Privaten aus Kostengründen nicht erfüllt werden können. Sie haben aber so hohe Personalkosten, dass sie oft nur zwei Ausstellungen im Jahr zustande bringen, und die sind wegen des Quotendrucks Block-Buster und langweilen mich meist. Ich habe unser Museum immer so betrieben wie die Unternehmen, die ich geführt habe, also sparsam und möglichst ohne Schulden und nach dem Ratschlag eines väterlichen Freundes: keine Banker und keine eitlen Manager!
FURCHE: Warum haben Sie Ihr Museum nicht in einer touristisch erschlossenen Gegend gebaut?
Liaunig: Ich glaube nicht, dass es dort so viele Kunstfreunde gibt. Der Sammler Karlheinz Essl hatte mir das damals geraten. In Klosterneuburg hatte er dann trotz des Einzugsgebiets von Wien nicht mehr Besucher als wir. Die Kultur hat es insgesamt nicht leicht in Kärnten. In Klagenfurt wurde das Fußballstadion zum Millionengrab.
FURCHE: und die Seebühne und das Brahmshaus in Pörtschach wurden abgerissen.
Liaunig: Fragen Sie zehn Kärntner, wer Brahms ist. Sie werden kaum einen Treffer haben.
FURCHE: Woran liegt das? Was müsste sich ändern?
Liaunig: Das liegt an den Schulen und am Bildungssystem. Auch zu uns kommen vorwiegend ältere Besucher, die kulturelles Interesse haben. Wir hatten bei einem Projekt mit dem Landesschulrat die 42 Kunsterzieher der Oberstufe in den Kärntner Schulen eingeladen, dass sie sich das Museum ansehen, um mit ihren Schülern zu uns zu kommen. Nur zwei von ihnen haben sich dazu entschlossen. Man sollte mehr auf Erziehung und Bildung wertlegen als auf den Erwerb von Kompetenzen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!