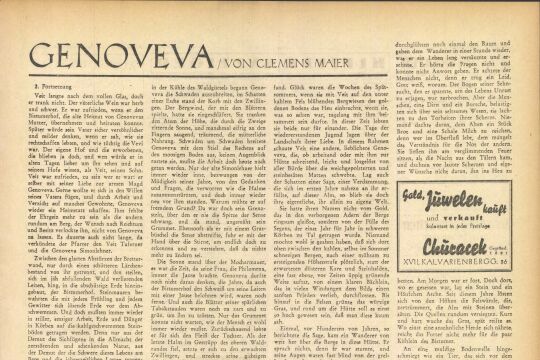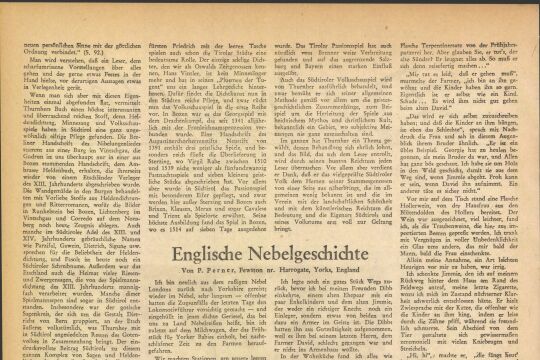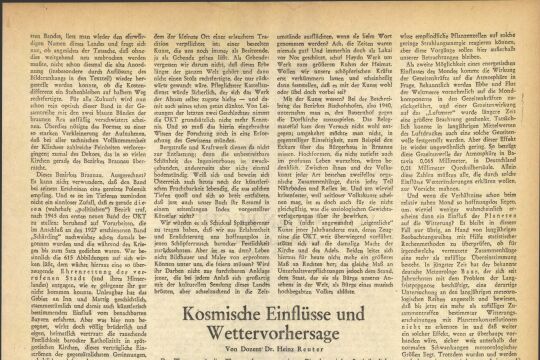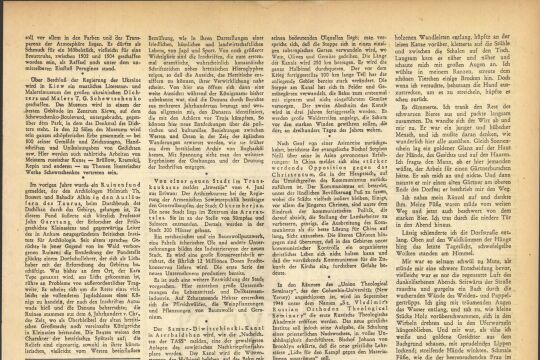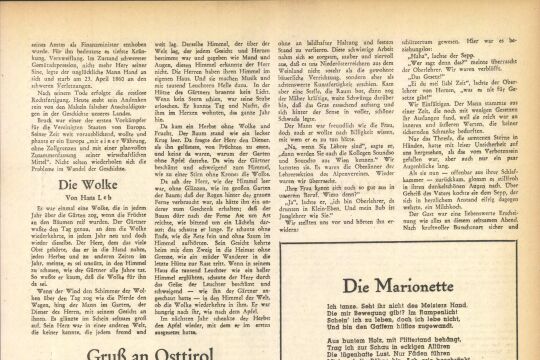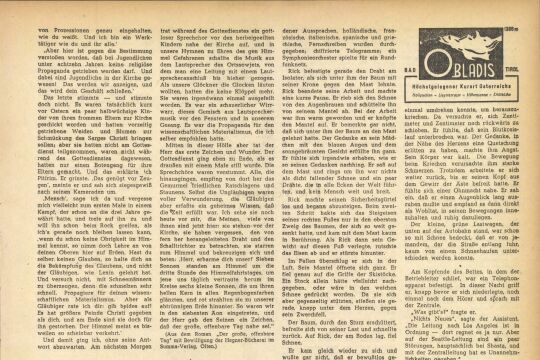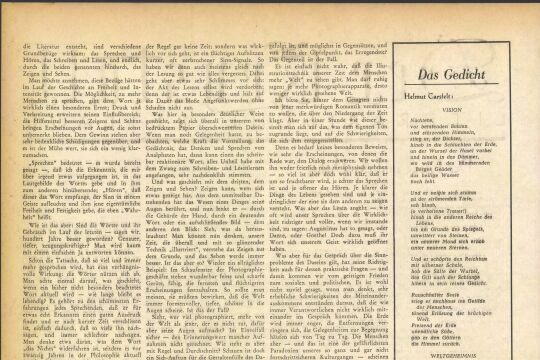Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Brot
Föhnigwarmer Wind peitscht klatschend schweren Regen an Hausmauern und Fenstersdieiben, überall gluckst und plätschert es und fließt behende durch unebene Rinnsale. Dort, wo die Straßen sich kreuzen und Gitter die Abflußkanäle decken, sammelt sich Abfall: ausgelaugte Zitronenschalen, Obstreste, leere Zigarettenpackungen, und mitten drinnen liegt auch eine dicke Scheibe Brot. Ich bücke mich und nehme das Brot in die Hand. Es ist echtes Kornbrot, goldbraun in der Rinde und weiß im flaumigen Kern.
Schon wieder weggeworfen, mißachtet, verunehrt“, rede ich halblaut im Selbstgespräch, dabei die Schnitte aufmerksam betrachtend.
.Ist doch eine Schande, diese Ehr-furchtslosigkeit vor dem Brote“, kommt es mir auch noch durch den Sinn. Gleichzeitig tauchen aber auch Erinnerungen auf. Sie hängen im Gehirn wie im Winterschlaf und tanzen gelegentlich zurück in die Gegenwart.
Es war im Spätherbst 1940. Athen hungerte. Brot war zur größten Kostbarkeit geworden. Die Zivilisten hätten Edelsteine für Brot gegeben, wenn sie bs hätten bekommen können. Im nachfolgenden kalten Winter, der manchmal den Nachschub ins Stocken brachte, begegnete uns wiederum der Hunger nach Brot. Diesmal war es am stillen Wolchow. „Zwölf Mann ein Brotl“ lautete der Befehl, und „Gold in den Taschen“ überschrieb damals eine Frontzeitung ihren Leitartikel und meinte damit die Brosamen in den Hosensäcken der Soldaten.
Ja, so war es wohl. Wir fanden es manchmal als unerträglich, und doch sollte es noch viel schlimmer kommen; denn wenige Jahre später saß ich in jugoslawischer Gefangenschaft. Wochenlang waren wir schon ohne Brot gewesen und hatten bei fett- und salzloser Wassersuppe schwerste Arbeit im Sägewerk, beim Brückenbau über die Drau oder bei
Aufräumungsarbeiten zu verrichten. Vorübergehend arbeitete ich mit zehn Kameraden auch auf dem Sportplatz. Hier war das Tagewerk etwas leichter; denn wir wurden stets vom gleichen Posten bewacht, und er war nett und barmherzig. Er sprach leidlich deutsch.
Unsere leibliche Not erkennend, führte er uns eines Tages anstatt auf den Sportplatz in ein Dorf, nahe dem Städtchen Pettau. Weizen sollten wir dort dreschen. Froh gelaunt und in Erwartung auf ein sättigendes Essen wanderten wir entlang einer endlosen Landstraße. Links und rechts lagen abgeerntete Getreidefelder. Verstreut standen noch einige Kornmandl wie zurückgebliebene Wächter auf den Äckern. Sonst war alles öd und leer und die heiße Julisonne brütete über den Stoppeln. Wir gingen langsam; denn wir waren schlapp vom Hunger und müde von der Arbeit der Vortage und dem harten, unruhigen Nachtlager.
Unser Bauer — ich nenne ihn mit Recht „unser“ — hatte schon allen Erntesegen in der geräumigen Scheune. Sie war weit unter das Dach mit den Garben des goldbraunen Weizens und mit hellgelbem Kornstroh gefüllt. Den Weizen begannen wir zu dreschen. Zwei Pferde trotteten um den Goppel, hurtig drehte sich das Schwungrad der Maschine, es sang und rauschte, die Körner spritzten hochauf, und es roch bald nach Frucht, Stroh und Staub. Wir Gefangenen arbeiteten wie richtige Bauern, bissen hart auf die Zähne und bekamen heiße Leiber. Schon waren zwei Stunden yergangen, da hielt der Bauer auf einmal die Gäule an und sagte im gebrochenen Deutsch: „Wer arbeiten, auch essen.“
Die Bäuerin, eine helläugige Slowenin, kam mit einem großen Korb. Sie richtete das Frühstück auf der Tenne. Wir saßen mit unterschlagenen Beinen in der Runde, aßen Äpfel und tranken keller-
kühlen Haustrunk. Daneben stand ein großer irdener Topf mit saurer Milch. Die Hauptsache aber war ein Laib Brot, groß wie ein Pfiugrad, rötlichbraun wie die Ackererde und hart wie Stein. Der herbe Duft der bäuerlichen Backstube umfing uns vertraut. Slowenisches Schwarzbrot, nicht anders als das unserer Bauern, vielleicht etwas größer und in dieser Notzeit auch ein wenig dunkler. Es ist nahrhaftes Kornbrot.
Fuchs, der Westfale, griff als erster nach dem Brote, weil es ihm am nächsten lag. Mit beiden Händen mußte er zupacken, so schwer war der Laib. „Das ist ein Brot“, meinte er und reichte es dem rechten Nachbar. „Und wie es duftet“, antwortete der, nahm es in die Arme und hob es zwei-, dreimal in Augenhöhe, so als wollte er das genaue Gewicht erkunden. Franz, der Bauer aus dem Burgenland, tat das gleiche und meinte auf seine Art: „Hätf nie im Leben gedacht, daß man vor hartem, trockenem Brot einmal soviel Ehrfurcht und Gier zugleich haben kann.“ Auch der nächste und übernächste faßte zu und alle in der Runde wogen ihn, den Brotlaib, und jeder sagte ein anderes Sprüchlein, und aus dem Munde aller klang eitle Freude und wahre Zufriedenheit. Um nichts in der Welt hätten wir dieses Brot vertauschen mögen.
Als der Laib wieder in der Hand des Westfalen lag, wog er ihn nochmals. Dann aber faßte er ihn kräftig mit der Linken, drückte ihn fest zwischen die Beine und an den Körper und machte drei Kreuze auf die flache Seite. Wir anderen verfolgten schweigend, doch mit Blicken voll Begier und Verlangen, jede seiner Bewegungen. Endlich stieß er das große Tischmesser des Bauern in die harte Kruste. Ordentlich fest mußte er
das Messer im Schafte halten und kräftig zustoßen; denn die Rinde war dick und leistete Widerstand. Das Brot ächzte und stöhnte und die Kameraden waren atemlos. Nur langsam schnitt Fuchs durch den trockenen Laib, dann fiel es plötzlich in zwei Hälften auseinander und hell leuchtete das Innere des Brotes auf. Wie zuvor strömte wiederum herber Duft in unsere Nasen, der Duft echten Kornbrotes. Wir schnitten dann Schnitte um Schnitte ab, groß und dick, wie es sich für arbeitsfreudige Drescher eben gehörte, daß wir mit beiden Händen zugreifen mußten. Gierig bissen wir dann in die wohlschmeckende Krumme und Stück um Stück vermahlten unsere Kiefer. Stumm waren wir während der ganzen Essenszeit. Erst als der Laib aufgezehrt war und jeder von uns nach Wochen der Entbehrung wieder einmal genug von dieser wahren Himmelsgabe genossen hatte, floß auch laut und ehrlich die alte Bitte des Vaterunsers über unsere Lippen: „Gib uns unser täglich Brot.“
Wir aßen an diesem Tage noch einen Laib und einen dritten und vierten durften wir teilen und in den Brotbeutel stecken, und als wir am Abend weggingen, lud uns die gute Bäuerin für die nächsten Tage zur Arbeit des Holzsägens ein. Wir sagten freudig zu und auch unser Wächter, der reichlich mit Lebensmitteln beschenkt worden war, gab zustimmend sein Wort. Das Schicksal aber wollte es anders. Unser Wachtposten wurde- ob seiner Eigenmächtigkeit eingesperrt und für uns kehrte das Glück dieses Tages nicht wieder.*-' Auch während der übrigen Zeit der langen Gefangenschaft kam kein ähnlicher Tag mehr. Wie ein helleuchtender Stern glänzt daher aus dem Dunkel einer gnadlosen Zeit dieser „Druschtag“ und bleibt uns ewig in Erinnerung.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!