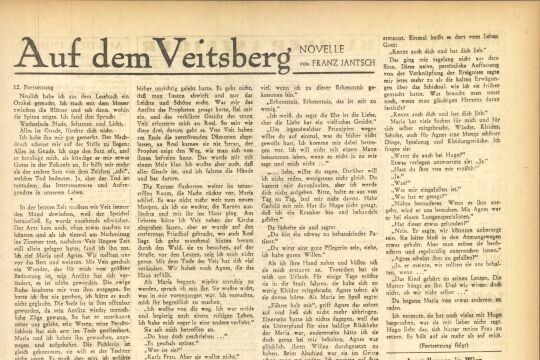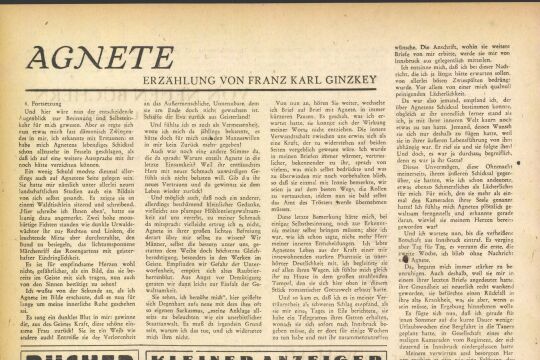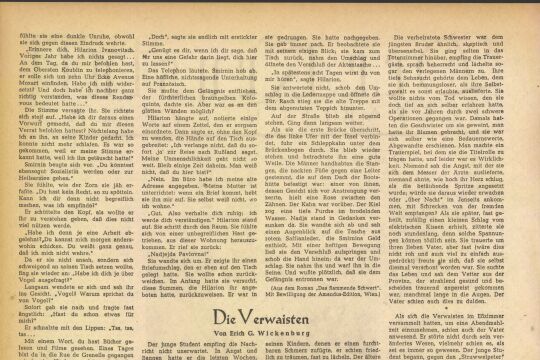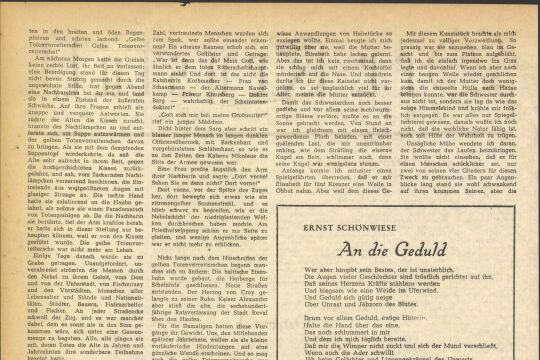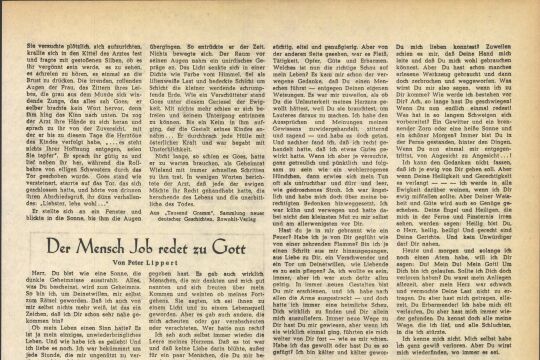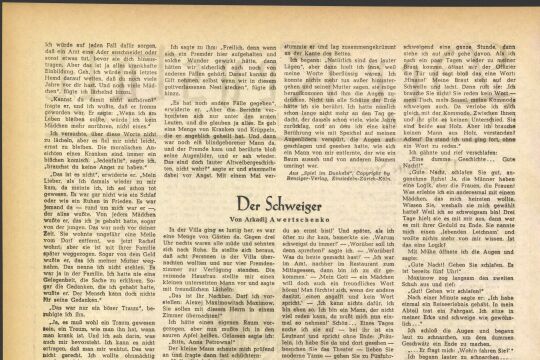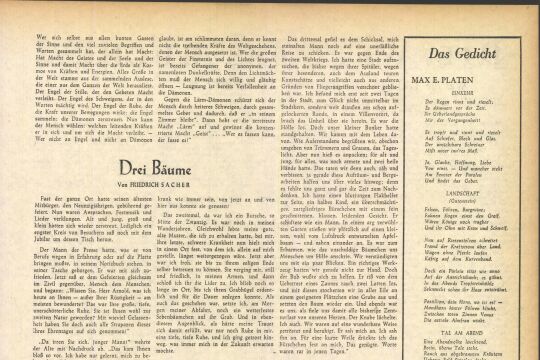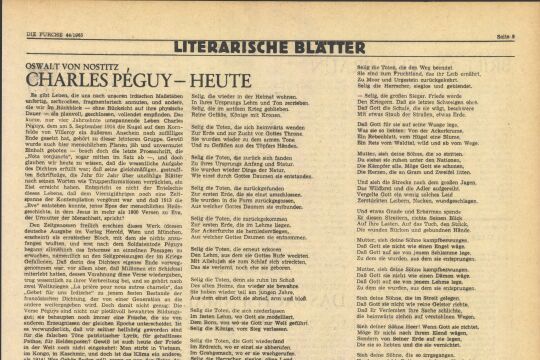Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die Gnade des Schmerzes
Als meine Mutter starb, stand sie im neunundachtzigsten Lebensjahr. Sie war, wie das in einem so hohen Alter zu sein pflegt, nicht lange krank, ja, sie legte ihrer Krankheit keine besondere Bedeutung bei, denn weder empfand sie Schmerzen, noch hatte sich in ihrem Befinden eine besondere Änderung ergeben.
Das Bibelwort „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ hatte bei ihr eine Veränderung erfahren, denn bei ihr hieß es „Liebe deinen Nächsten mehr als dich selbst“. Sie liebte die Menschen, wie sie ihre Blumen liebte, sie liebte alles, was Gott geschaffen hatte, und am meisten liebte sie ihn, den Schöpfer aller Dinge. Jeder, der das Glück hatte, meiner Mutter zu begegnen, verließ sie mit mehr und neuem Mut. Ihre blauen Augen waren wie zwei Sterne, die Wärme, Güte und jenes Vertrauen ausstrahlten, das aus dem Herzen kommt und nur sehr schwer erlernt werden kann. Nachdem sie nichts vom Leben wollte als das Geschenk, sich jedes Tages freuen zu dürfen, war sie ein glücklicher Mensch. Glücklich auch deshalb, weil sie nicht mehr begehrte, als ihr vom Schicksal zugeteilt war. Sie freute sich mit der Freude des andern und tröstete ihn, wenn er einsam und bekümmert war. Gab man ihr ein Geschenk, so dachte sie sogleich darüber nach, wer damit eine noch größere Freude haben könnte — und gab es ihm weiter. Zeigte man sich damit unzufrieden, so lächelte sie ihr stilles, versöhnendes Lächeln und sagte: „Die Freude, die ich mit deinem Geschenk einem andern machen konnte, hat mich erst wirklich glücklich gemacht, und das wolltest du doch, mich glücklich machen.“
Meine Mutter wäre kein vollkommener Mensch gewesen, wenn sie nicht Humor besessen hätte. Bis zuletzt behielt sie ihn. Wenige Tage vor ihrem Ableben beklagte sich ihre Nachbarin, daß ein längeres Gespräch mit meiner Mutter nicht möglich wäre, da sie es vorzöge, den ganzen Tag zu schlafen. Darüber befragt, blickte mich meine Mutter vergnügt an und sagte mir leise: „Leider sind die Gespräche meiner Nachbarin so schrecklich langweilig, weil sie von nichts anderem als vom Essen handeln, und wenn sie damit anfängt, bin ich gezwungen, mich schlafend zu stellen.“ Darüber lachten wir beide herzlich, und es war das letztemal, daß ich dieses Lachen sehen und hören durfte. Zwei Tage später traf mich die Nachricht, daß meine Mutter ihr Leben beendet hatte. Sie war aus dem Bad gekommen, hatte sich schön gemacht und sagte freudestrahlend zur Schwester: „Heute nachmittag kommen die Kinder!“ Mit dieser Freude in den Zügen hatte sie sich zurückgelegt — und ihr Herz hatte zu schlagen aufgehört.
Als ich die Nachricht erhielt, traf mich der Schmerz mit einer so furchtbaren Gewalt, daß ich ihn nicht empfand, sondern glaubte, sterben zu müssen. Das Leben, wie es eben noch war, hatte sich grundlegend und für immer verändert. Alles um mich herum war grau und zu einem Mechanismus geworden, der atmete und sich bewegte, aber tot war und nicht mehr lebte. Ich wußte, daß ich mit der Mutter auch deren Liebe und Gebet, die mich wie ein sicherer Schutz umgeben hatten, verlustig geworden war. Ich war einsam in der Welt, und mit dem Gefühl der Einsamkeit breitete sich der Schmerz in meiner Seele aus und brannte dort wie eine einzige tiefe Wunde.
In der ersten Nacht nach ihrem Tode kam meine Mutter zu mir. Von Tränen und Qual erschöpft war ich eingeschlafen, als mich plötzlich etwas aus dem Schlaf riß, so daß ich auffuhr und mich hellwach im Bett aufsetzte. „Mutter!“ rief ich denn ich wußte, sie war da — aber es war nichts um mich als ein wunderbarer Duft von Blumen, der mit einem überirdischen Gefühl des Trostes verbunden war.
Wie lange dieses Gefühl gedauert hatte, weiß ich nicht, aber ich weiß, daß es langsam zu Ende ging und ich mit meinem Schmerz allein zurückblieb.
Es war wie ein geheimes Verlangen oder wie eine geheime Abmachung, die mich zwang, viele Wochen hindurch jede Nacht vor das Tor des Friedhofes zu fahren, auf dem meine Mutter ruhte, und dort nach den Gräbern und den Lichtern zu starren, die in den dunklen Nächten, weithin verstreut, flackerten und brannten.
Und so kam endlich Trost zu mir, den ich als eine tiefe und große Gnade empfand: die Gnade des Schmerzes. Der Schmerz war das letzte, das mich mit meiner Mutter verband, und so wollte ich ihn für immer und als etwas Lebendiges in mir behalten und bewahren. Ruht in Frieden, ihr stillen Toten, der Schmerz um euren Verlust brennt in uns wie das Licht, das wir auf euern Gräbern entzünden. Meine Mutter lebt im Schmerz in mir weiter — und so ist der Schmerz eben Gnade, die vergangenes Leben unvergänglich macht, und das wollte ich dir, meine liebe Mutter, jetzt im Herbst, wo das Jahr uns verläßt, noch einmal sagen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!