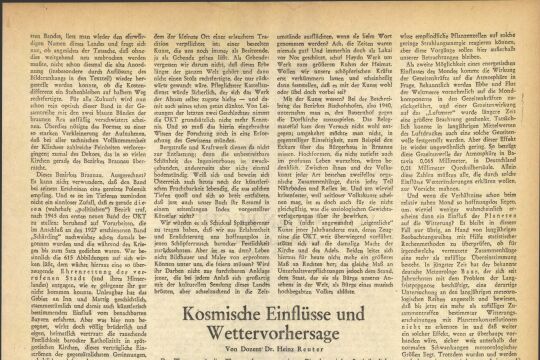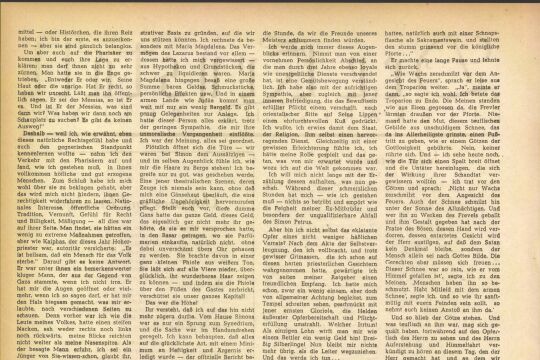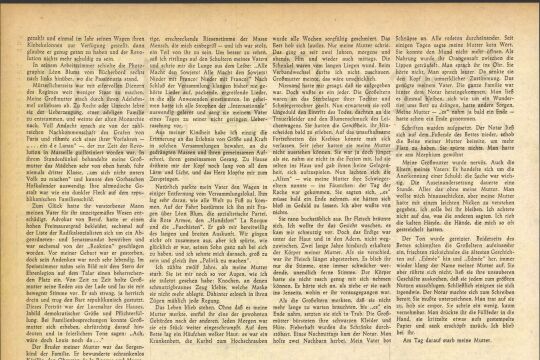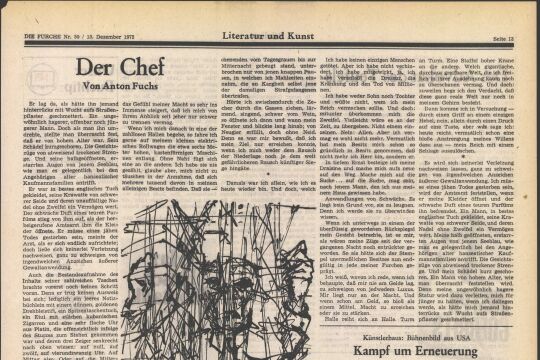Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
"lch, líebe das broschierte Buch"
Da sehe ich im Licht des Jahres 1908 (mir scheint, es war völlig anders als das Licht nach zwei Weltkriegen), sehe ich leibhaftig, jung, heiter, an einem Junimorgen meinen Französischlehrer auf der Fensterbank sitzen. Er trägt eine Baskenmütze, raucht eine Pfeife und liest mit braunen, wachen, vergnügten Augen in einem soeben vom Postboten gebrachten Buch. Das Papier des Paketes liegt noch auf dem Boden zu seinen Füßen, er schlägt bisweilen mit der Fußspitze des überschlagenen Beines daran, das Rascheln stört ihn nicht. Er liest, er lächelt, sein brauner gallischer Schnurrbart hebt und senkt sich beim Lächeln; in seinen festen, kurzen Fingern hält mein Lehrer und Freund ein schmales, langes Messer aus Elfenbein. Jetzt faßt er das Buch und schneidet mit einem leisen, vertrauten Ton, diesem Ton im Winde wetzender Schilfblätter, gespannt, nachdenklich, immer noch heiterer und unendlich behutsam: von unten nach oben, dann oben quer durch, und nochmals von unten nach oben die bis zu diesem Augenblick nie eingesehenen Seiten auf, er eröffnet sie, legt sie auseinander und liest mit Behagen wie ein Eroberer, der von sicherm Sieg zu sicherm Sieg in ein herrlich sich erschließendes, weites Land vordringt. Er liest sein Buch, sein nur ihm gehörendes broschiertes Buch, das so leicht und vertraut, gelb, wie alle seine Vorgänger, in seiner festen Hand ruht; eben war es noch eine verschlossene Knospe, jetzt ist es aufgeblüht, hat sich aufgetan — und schon spielt der Morgenwind mit diesen Blättern, bewegt sie, schlägt eine Seite zurück, so daß der Lesende sie wieder wenden muß —, aber nein, ein Wort ist ihm ins Auge gefallen, er hatte soeben darüber weggelesen, jetzt, bevor er wieder vordringend mit seinem dem Stoßzahn des Elefanten abgewonnenen Dolch aufs neue schneiden darf, hält er inne, und er liest die Stelle nochmals, den einen Satz, zu dem der Morgenwind ihn zurückgeführt hat, und er wird nachdenklich, sein Blick wird tiefer, das Lächeln inniger, er legt das Messer zwischen die Seiten, dorthin, wo sein bisheriger Weg ihn hingeführt hat, er schließt das Buch und beschwert es mit einem blauen, flachen Kieselstein, den er droben im Bachtal unter den Eschen,’ wo der Frauenschuh wächst, beim Morgenspaziergang gefunden hatte.
Vielleicht wird er das Buch lieben, dann wird er es zum Buchbinder tragen. Er wird es binden lassen, wie alle Bände, zu denen er oft zurückkehrt, so daß sie nun nebeneinander stehen und eine warme goldbraune Wand bilden, die mit der Zeit auf die ändern Wände übergreift und schließlich den Lesenden, der nun schon weiße Haare hat, umschließt, während die ändern, die broschierten Bände, draußen im Hausflur, droben auf dem Boden liegen. Viele wurden schon verworfen, ausgeschieden, aus dem Hause verwiesen, viele warten noch, werden hin und wieder plötz-lieh gewählt, herangezogen, nochmals gelesen, mit so völlig anderer Einstellung als das erstemal. Sie haben sich auch selbst verändert im Laufe der vorüberziehenden Jahre. Sie waren einst zu früh gekommen. Jetzt schlägt ihre Stunde, und sie entfalten sich.
Bisher war von meinem Freund, dem Französischlehrer, die Rede. Er saß da am Fenster als Statthalter und Stellvertreter eines ganzen Volkes, das zu lesen weiß wie kaum ein anderes.
Wir bekommen meist die Bücher gebunden ins Haus, kartoniert, wie es so schön heißt, mit Buchdeckeln in allen Farben, jeder anders, so daß sie aneinandergereiht zerklüftet wirken, laut, ein jeder Band sich selbst als einzigartig postulierend. Schwarz wie chinesische Tinte, rot wie der Höllenbrand und schwefelgelb wie die Fahnen der Quarantäne oder Kontumaz. Schon der Einband scheint einem etwas Unwidersprechliches zuzurufen. Sie sind aufgeschnitten, mit Daumen und Zeigefinger lassen sich die Seiten wenden, ungeduldig, rasch wie der mischende Kartenspieler kann man sie über die Fingerspitze rauschen lassen, man kann sie von der Mitte aus, man kann sie nur am Ende lesen, man kann sie auch nur aufstellcn — und nie wird jemand wissen, daß man sie nicht gelesen hat. Da ist kein Einblick möglich in die Art, wie sie einst behandelt wurden, da hat die Passion, das Mitgerissensein des Lesers, nirgends den Schnitt so eilig angebracht, daß die Seiten rissen, und die Teile, die er ungelesen ließ,
sind nicht zu erkennen.
Auf meinem Bücherregal stehen zwölf
Bände, sie enthalten die Werke Barbey d’Aurevillys, ein jeder der Bände ist vom
Autor mit röter, bisweilen mit goldener Tinte dem Freunde, François Coppée, gewidmet, in einem Bande steht: „A Francois Coppée de l’Academie Française de celui qui n’en sera jamais. Barbey d’Aurevilly.“
In den zwölf Bänden, die etwa 4000 Seiten umfassen, waren, als ich sie erwerben konnte, 27 Seiten aufgeschnitten. Diese Bände erzählen ihre Geschichte selbst, aber die kartonierten, anonym unter dem Hackbeil er- öffneten, berichten nichts über ihr eigenes Ergehen. Nie werden wir wissen, ob ihr Leser den weiten Weg von der ersten Seite des ersten Bandes bis zur letzten des zweiten vollzogen hat, oder nur den Weg des Holzwurms von jener ersten bis zu jener letzten, der so kurz ist, daß er nur durch die beiden Kartondeckel hindurchführt, da bekanntlich in einer Bibliothek die erste Seite des einen Bandes gleich neben der letzten Seite des zweiten liegt.
Wir sind, auch wenn wir bedächtig tun, in unserm Sprachbereich ungeduldige Menschen, wir wollen sofort wissen. Wir haben aber nötig, uns das nachdenkliche Genießen anzueignen. Auch ich selbst habe Jahre gebraucht, um zu lernen, mit Freude leichte, broschierte Bände mit dem Papiermesser in der Hand zu lesen, erst die Geduld des Alters hat mich gelehrt, was mein Freund damals im Jahre 1908 schon so wunderbar beherrschte. Und nun liebe ici die broschierten, unaufgeschnittenen Bände, ich habe ihren Sinn erfaßt. Auch ich treffe jetzt eine Auswahl unter ihnen und freue mich, wenn sie zum Binden reif werden.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!