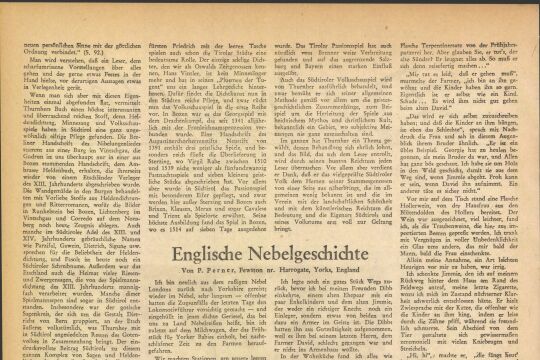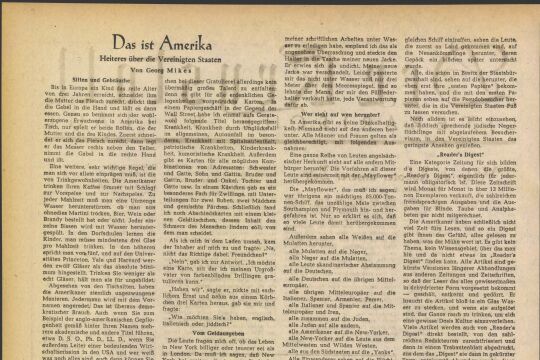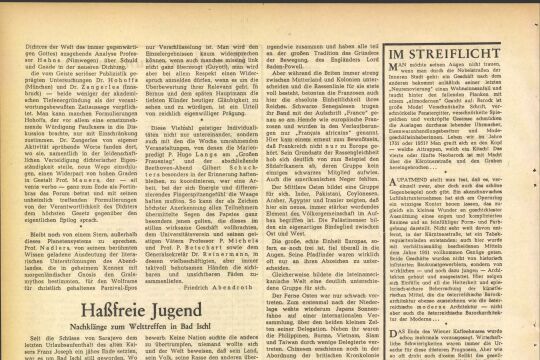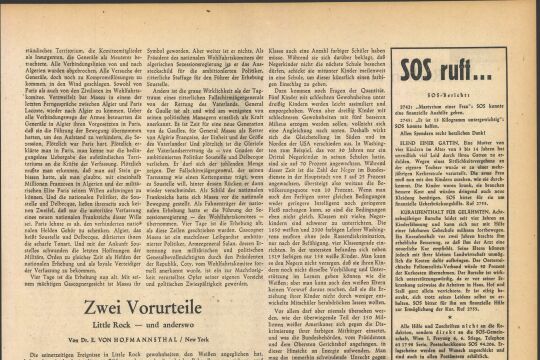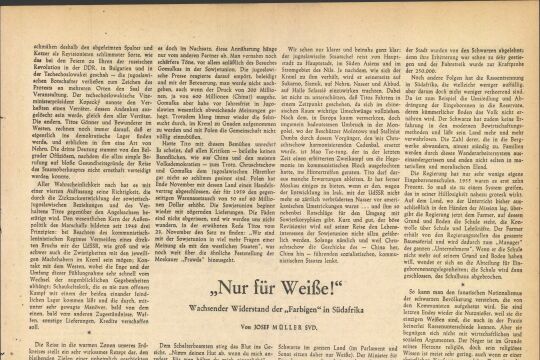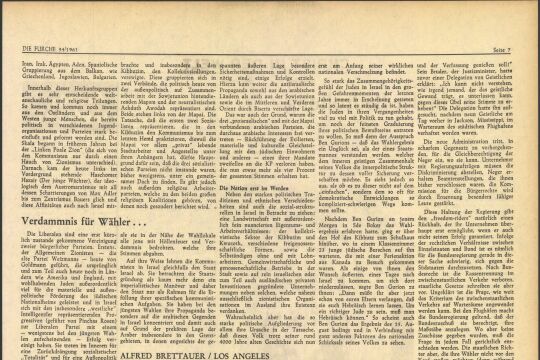Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Lunch in Harlem
UM DAS NEGERVIERTEL IN NEW YORK, Harlem, kennenzulernen, muß man einen guten Fremdenführer haben. Meiner hieß Thomas, ein gesuchter Zeichner der weltbekannten Blätter. Er kam in Begleitung eines Negermädchens. Es hieß Gladys.
Gladys hat eine sienabraune Haut. Die Haare sind fast dunkelblau. Der fette Hautglanz ist längst weg. Nur die helle Farbe des Handtellers, Zeichen ihrer Rasse, ist noch sichtbar. Gladys ist Kundin in einem der besten Modesalons in der Fünften Avenue, die immer noch als die teuerste Straße der Welt gilt. Das Kleid, das Gladys trägt, ist faszinierend. „Eine black Lady“, sage ich.
„RENAISSANCE EINES VOLKES“, hört man allerorts, und es stimmt, weil man in diesem Satz die Fortschritte der schwarzen Rasse in wenigen Jahrzehnten der „amerikanischen Lebensweise“ erkennen kann; Harlem von ehedem ist nicht mehr das Harlem von heute. Hunderttausende strömten aus dem Süden Amerikas nach New York und werden immer wieder von den Negerführern nach Harlem geholt; so viele, daß schon Stimmen laut werden, die von einem empfindlichen Arbeitermangel im Süden sprechen.
Der oberflächliche Beobachter sieht In Harlem nichts anderes als einen Stadtteil von New York, dessen Straßen sich in nichts von den „anderen“ Straßen und Gassen unterscheiden. Nur begegnet man mehr Negern als Weißen, man hört mehr Musik und Gesang und die Kirchen sind pompöser als sonstwo geschmückt. Und dennoch ist Harlem die Hauptstadt einer Rasse geworden, die sich in einer fast flammenden Bewegung zu neuem Aufstieg befindet.
Wenn es einem gelingt, tiefer hineinzuhorchen, über die bedeutungslosen schwarzen Massen hinweg, in das seelische und geistige Leben, dann hört man etwas von einer „Renaissance des schwarzen Volkes“; man hört Gedichte und Lieder und Vorträge, die weit von den gemachten Niggeisongs und Spirituals der Großstadt-Shows des Broadway entfernt sind.
We have tomorrow bright before us like a flame.
Yesterday, a night, gone thin a sun-down name. And dawn today, broad arch above the road we come. We march!
(In freier Übersetzung: „Wir haben das Morgenhell vor uns wie eine Flamme. Die Nacht von gestern versinkt im Wesenlosen. Die Frühdämmerung des Heute wölbt sich über unseren Weg wie ein breiter Bogen. Wir kommen. Wir marschieren I“)
DAS SÜDLAND MIT SEINEN grausamen Erinnerungen soll vergessen werden; aus den Sklavennegern der Plantagen wurden die „New Negroes“, die sich nicht, wie es manche andere Völker machen, in eigenen Vierteln zusammenfinden, um dort zu arbeiten und zu leben. Diese Neger findet man überall in New York. Man versuchte, den Zuzug nach New York dadurch zu verhindern, daß man ihnen keine Wohnungen gab, keine Hypotheken auf ihre Häuser; aber mit einer verblüffenden Leichtigkeit bezahlten die Neger die gekauften Häuser. Und ist einmal ein Neger in ein Haus mit Weißen eingezogen, ziehen alle Weißen aus. So ging der Vorschub mit dem Tempo einer Fluchtpsychose rasch vor sich.
Oft hört man die Geschichte von Mammy Pig Foot Mary, die in einem Haus in der Lenox Avenue runde zweiundvierzigtausend Dollar auf den Tisch legte; eine arme, alte Niggerfrau.
Oder jene andere Mary, die in ganz Harlem Schönheitssalons für Negerfrauen und Negermänner einrichtete, um nach ihrer Methode das Kräuselhaar in das glatte Haar der europäischen Frisuren zu wandeln, und damit Millionen verdiente, die sie allerdings wieder für soziale Zwecke ausgibt.
MIT DEM LEBEN IN DER MILLIONENSTADT sind auch die Negerlieder verlorengegangen, die Nigger Songs mit ihrem weichen, wehmütigen
Glanz; jene Lieder, die aus einem Volksganzen kommen müssen, wenn dieses auch leidet und versklavt ist. „Gerettet“ wurden nur die berühmten Spirituals mit ihren afrikanischen Rhythmen und King Jones' Versionen der Bibel, wir finden in den Weisen den Glauben, die Angst, die Hoffnung und den Zweifel, die theologischen und ethischen Anschauungen. Gesänge, die jahrhundertealt sind und erst in den letzten fünfzig Jahren gesammelt wurden.
Seit dem Welterfolg des New-Orleans-Jazz um 1920 haben die Amerikaner die Negermusik für sich in Anspruch genommen. Die großen Grammophongesellschaften und Revueleute schaffen Imitationen, die mit der wirklichen Negermusik nichts mehr zu tun haben. Die Neger haben aber auch ihren eigenartigen Dialekt verloren, der ihnen einst von den Gullahs (an der Westküste Afrikas) mitgegeben wurde.
WIE STARK DIE NEGER in New York geworden sind, bemerken wir auf unserer gemächlichen Fahrt durch Harlem. Eine große Anzahl von Schulen, von Klubhäusern und Kirchen und Kongregationen, Häuser mit großen Wohnungen und Bädern entstanden hier. Daneben aber findet man auch verfallene Ruinen, voll von Schmutz und der gleichgültigen Un-sauberkeit einer niederen Klassenschichte; die Fensterrahmen von ungewaschenen, rotgeblümten, zerrissenen Tüchern verhängt; ein kahles, erbärmliches Nichts; mit braunem, altem Papier verklebte Wände in Fluren und finsteren Stiegenhäusern, auf deren schmierigen Stufen zahllose Negerkinder spielen.
Es ist der Vortrupp der schwarzen Rasse, der in der La Salle Street nur, einige Häuser von der stolzesten amerikanischen Straße, dem Broadway, entfernt ist. Und dort versteht man die Weißen, die vor den Negern die Flucht ergreifen.
IN EINEM KLEINEN NEGERKLUB haben wir gegessen. Hier verkehren alte Negermänner, die sich ihr Sümmchen erspart haben und jetzt das Leben im Nichtstun genießen. Alte Leute, mit erdbraunen Gesichtern und den sonderbar auffallenden grauen Haaren der Schnurrbarte und Augenbrauen; Männer, die eine weiße Krawatte trugen, einen Spazierstock, deren Frauen, wenn auch bunt, so doch mit gewissem Schick gekleidet waren. Die Tische waren sauber und weiß gedeckt, Blumen in den Vasen. Das Essen — die Negerfrauen sind bekanntlich erstklassige Köchinnen — gut und besser als in den meisten amerikanischen Speisehäusern. Es gab keinen Lärm und keinen Auftritt; die Leute waren still und saßen bescheiden und lachend unter den rotschimmernden Lampen.
„SIE WOLLEN EINEN ECHTEN BLUES HÖREN?“ fragte Gladys. während sie der Kellnerin winkte, abzuservieren. „Da sitzt Weldon; er singt in einem Negernachtklub, ich glaube Cottonclub oder Small Paradise, ich gehe nicht in diese Lokale, die Weißen haben sie uns wieder genommen.“ Dann lächelte sie Weldon zu, der sie verstand: er nahm ein Banjo und sang und tanzte mit seiner Begleiterin einen Blues.
Ein Blues, den er nur singt, wenn nur Neger im Lokal sind. Sonst interpretiert Weldon die Imitationen der Grammophongesellschaften.
Hundertmal in kurzer Zeit kann man diese fast unüberbrückbare Kluft fühlen, überall. Diese Trennung zweier Rassen. Gewiß, wir „drüben“ auf dem „alten“ Kontinent haben das Negerproblem von der Seite einer Massenwanderung nicht kennengelernt. Wir sind Europa, wir waren es, wir werden es bleiben.
Hier ist es vielleicht das einzige Mal, wo die Theorie des „Schmelztiegels“ versagt. Für uns ist es schwer begreifbar, daß man im italienischen Viertel fortgesetzt Italiener trifft, die seit zehn und zwanzig Jahren hier leben, ohne ein Wort Englisch zu sprechen, da sie eine eigene Stadt bilden, eigene Schulen haben, eigene Zeitungen und ihr eigenes italienisches Leben führen.
Nach dem Lunch sind wir durch die Lenox Avenue gefahren, durch die Straßen, in denen die reichen Neger wohnen. Wir haben Neger als Taxichauffeure gesehen, zahllose Neger-geschäfte, Negerbarbiere, Negerpolizisten, Postämter mit Negerangestellten und schwarze Kaufleute. Harlem ist schwarz. Aber seine Häuser und Kirchen haben Amerikaner gebaut und vor ihnen Holländer. Wir hätten noch
Schulen und Kindergärten sehen können, schwarze Boy Sco.uts, Pfadfinder-gruppen und eine Menge sozialer Einrichtungen.
KEINE BARMHERZIGKEIT will das schwarze Volk, aber • Gerechtigkeit; kein Mitleid, aber dafür mehr Verständnis.
Jene Neger, die die Stufen der Allgemeinbildung erklommen haben, arbeiten mit einem fast wilden Eifer daran, den armen Schichten zu helfen; es ist Geld da, unheimlich viel Geld.
Und für Geld kann man hier in Amerika alles haben.
Es ist schwer faßbar, wie sehr sich hier eine Rasse innerhalb einiger Jahrzehnte geändert hat, und man begreift langsam die Unsicherheit, mit der man in Amerika den Problemen der Neger gegenübersteht.
AUF DER ANDEREN SEITE der Straße sehen wir einen eleganten Neger auf einem hohen Stuhl sitzen, und ein alter, weißer Mann putzt seine hellgelben Schuhe.
„Singen Sie doch ein Lied, Sir, hören wir den Neger sagen, „dann geht die Arbeit leichter...“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!