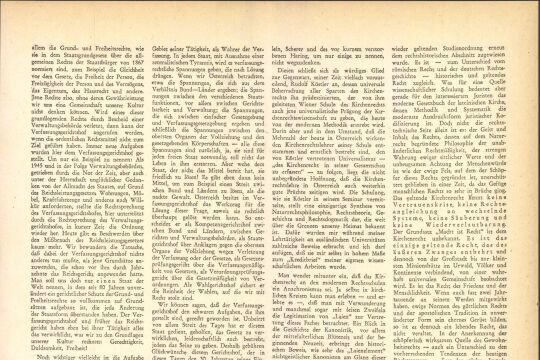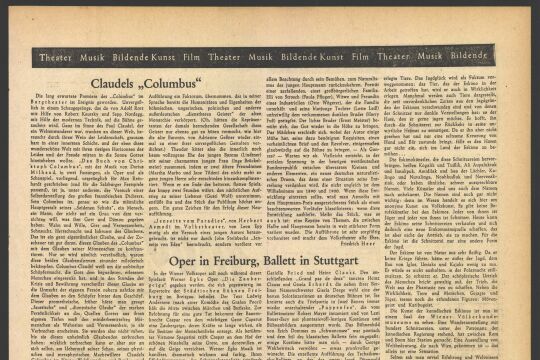Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Moderner Totentanz
Eugène Ionesco wehrt sich entschieden dagegen, als Vertreter des absurden Theaters abgestempelt zu werden. „Mein Theater ist ein Theater, das das Absurde denunziert.” Darum hatte er bisher alles darangesetzt, das Absurde durch Komik zu ersetzen. Aber schon in dem in Wien noch unbekannten „Fußgänger der Luft”, dessen Held ebenso wie in den beiden vorangegangenen Stücken „Mörder ohne Bezahlung” (Volkstheäter) und „Die Nashörner” (Josefstadt) Behringer (Bérenger) heißt, hatte Ionesco sein Pathos gefunden. In dem letzten der „Behringer- Stücke”, dem nunmehr im Akademietheater aufgeführten „Der König stirbt” (Le roi se meurt), ist dieses Pathos bis zum Lyrismus gesteigert und gemahnt stellenweise an Claudel oder sogar an barockes Welttheater. Ein König, ein Mensch, ein Jedermann erlebt widerstrebend die Stunde seines Todes. Dieses lange, langsame, wortreiche Sterben währt ohne Pause von 20 bis 22 Uhr. Seine zwei Gemahlinnen sind um ihn: die verstoßene, die zum strengen Todesengel anwächst, und die lebenslustige Gegenkönigin, die Trost, Liebe und blinde Hoffnung verkörpert. Der Hofstaat ist auf drei Personen zusammengeschrumpft : den Leibarzt, der zugleich Astrologe und Henker ist, die getreue Magd und eine derbe, einfältige Leibwache, die des Königs Hinfälligkeit Phase um Phase wie ein närrischer Herold verkündet und einen possenhaften Ton in den zunehmend beklemmenden Vorgang hineinbringt.
Wie sein Herrscher, so verfällt auch das Reich. Erdbeben und Meeresfluten verschlingen das Land, es wird niemand mehr geboren, die Endzeit bricht an. Es ist eine mythische Welt, ein zeitloser Hof — und Behringer ein allegorischer König. Denn jeder Mensch ist König seines Universums, das mit ihm vergeht, sich über Jahrtausende erstreckt und plötzlich nur Minuten hat. Behringer wehrt sich verzweifelt gegen das Unausweichliche, durchläuft alle Stadien von jähem Grauen über ohnmächtige Anklagen bis zur unwürdigen Raserei und wird am Ende immer passiver, immer losgelöster, immer nackter, immer mehr Mensch. Die Todesgöttin geleitet ihn hinaus aus den Absurditäten dieser Welt: „Beuge dich über dein Herz, geh in dein Herz. Geh in dein Herz, es muß sein.”
Durch radikale Kürzungen namentlich im breit ausgewalzten Schlußteil dieses Wortoratoriums (Gang des toten Königs ins Schattenreich) ließe sich aus dem fast zweistündigen Einakter ein bedeutendes kurze Stück von Ionescos; Theater gewinnen, das wenn schon nicht als sein bestes, doch als sein persönlichstes anzusprechen ist. In der Inszenierung von Helmuth Matiasek fehlte dem Stück die nötige geistige Spannung und Dichte, bedingt vor allem durch die unzureichende Besetzung der Hauptfigur. Günther Haenel spielt als König wohl die groteske Hinfälligkeit, aber seinen leidenschaftlichen Protesten fehlt die Größe und Verzweiflung. Besser bestand Blanche Aubry als unerbittliche Todeskönigin, wogegen Erika Pluhar als die dem Leben zugewandte, liebende Frau, weniger überzeugte. Inge Brücklmeier war die bekümmerte Magd, Achim Benning ein nur wenig komischer Wächter, während Manfred Inger als Arzt fast unbeteiligt wirkte. Das Bühnenbild von Matthias
Kralj zeigte einen aus Photomontagen zusammengesetzten Kuppelbau und charakterisierte anschaulich die Atmosphäre des allgemeinen Verfalls. Der Beifall war eher zurückhaltend.
Das Theater in der Josefstadt hat mit der Aufführung von „Kasimir und Karo- line” Ödön von Horvath wiederentdeckt. Er hat fast alle seine Stücke in dem Jahrzehnt zwischen 1928 und 1938 geschrieben und darin die folgende „Eiszeit der Herzen” vorweggenommen. Horvath sah weit, auch in die Zeit. Er erspähte schon jenen Herrn Karl, der uns noch heute so viel zu schaffen macht. Denn er besaß einen Blick für das kleine Volk wie kaum einer; aber seine Volksstücke sind weltenweit von aller Sentimentalität dieser alten, fast untergegangenen Gattung.
Kasimir, der Schwerfällige, und Karo- line, die Lebenshungrige, sind einander zugetan und verlieren sich dennoch auf dem großen Rummelplatz des Lebens, für den das Münchner Oktoberfest stellvertretend steht. Daraus wird etwas wie eine dramatische Ballade, in der sich der Witz in den Ernst, der Spaß in die tieftraurige Elegie fügt. Keiner gab seinen Personen so kurze Auftritte wie Horvath. Erst die Summe der Augenblicke verleiht seinem Stück Bewegung und Farbigkeit. Der Erfolg der Neuauffübrung in der Josefstadt ist vor allem dem Regisseur Otto Schenk zu danken. Er inszenierte die Augenblicke, die Erregungen, die Wechselgespräche, die zartverhaltenen Stimmungen. In den phantastischen Bühnenbildern von Günther Schneider-Siemsen scheint in der Licht- und Bilderflut nicht die Münchner „Wiesn”, sondern die Welt in Bewegung zu geraten. Einprägsam die Darsteller. Um nur einige zu nennen: Eva Kerbler (Karoline), Alfred Böhm (Kasimir), Luzi Neudecker als verschüchterte Erna, Kurt Sowinetz als ihr brutaler Merkl Franz, Franz Messner, ein serviler Kavalier, Erik Frey und Carl Bosse als recht eindeutige „Onkels”. Es gab starken Beifall, besonders für den Regisseur.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!