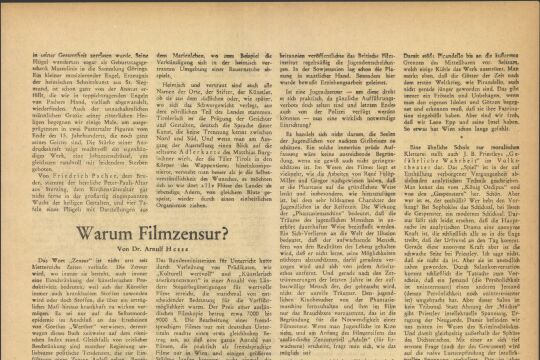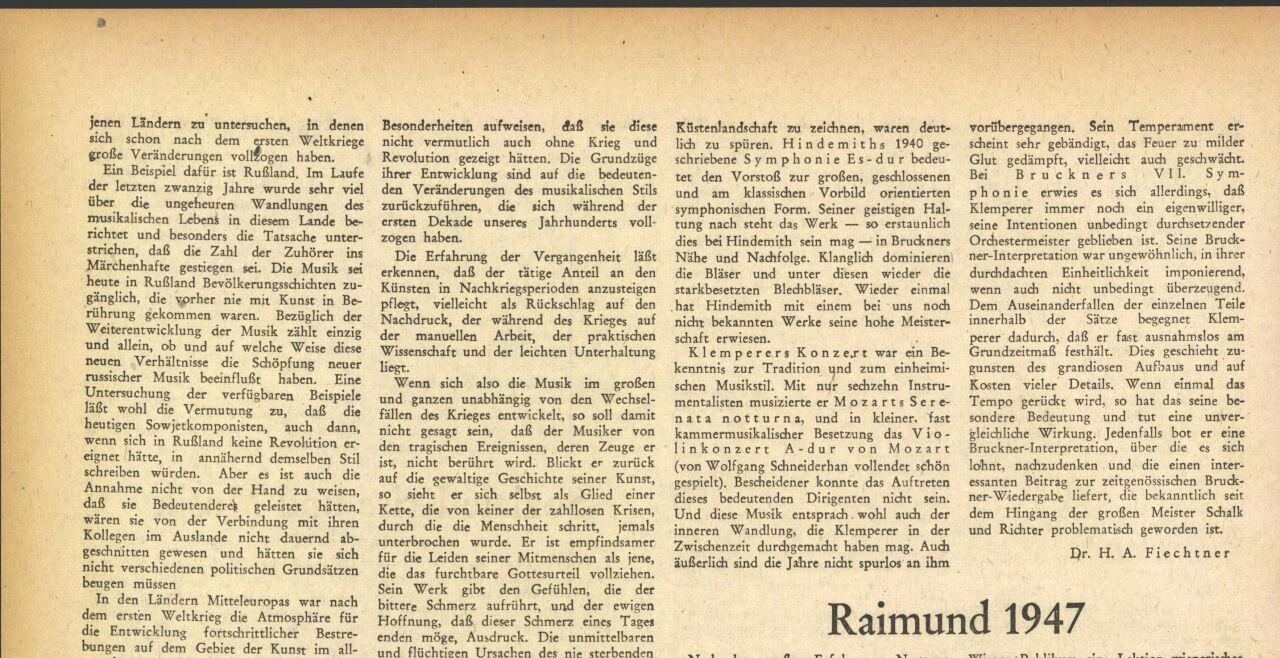
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Raimund 1947
Nach dem großen Erfolg von Nestroys „Talisman“ in der Josefstadt haben sich die Wiener Theater dem zweiten Klassiker des Wiener Volksstückes, Raimund, zugewandt. Das Volkstheater bringt „D i e gefesselte Phantasi e“, im Bürgertheater erlebt „Der Verschwen-d e r“ seine Auferstehung.
Es ist etwas Seltsames um diese „Zaubermärchen“ von 1830 auf der Bühne von 1947! Das Gemisch von baroc' r Phantastik, voliks-hafter Legende und angelesener „klassischer“ Pathetik wirkt heute nicht sehr erfreulich. Wenn sich Raimund in Allegorien und symbolischen Exotika bewegt, dann vermag uns dies vielleicht von ferne zu rühren, wenn wir dabei der Schaubühne des Praters in unseren Kindertagen gedenken: ein „Armer Spielmann“ — Erlebnis, „Musik der Kindheit“, nicht ohne peinlich sentimentalische An hauchung. Wenn sich Raimund aber nun gar, was der Unglückliche bekanntlich nicht lassen konnte, in höhere Töne versteigt, dann wirkt diese Erweichung der Schillerschen Phraseologie ins Wienerisch-Treuherzige zuweilen platt, „naiv“, nicht im schlichten, sondern im schlechten Sinn des Wortes. Kein Kulissenzauber kann hier echte Atmosphäre des Zauberischen schaffen, die vielbemühten, vielbefrachteten symbolischen Figuren tänzeln, mit unechtem Flitter behängte Marionetten, über die Bretter der Bühne, die hier weder Himmel noch Erde, weder Welt noch Überwelt deutsam bedeuten.
Armer Raimund 1947! — ? Ach nein, armer Wiener von 1947! Denn siehe: die Masken, ja selbst die äußere Thematik des Spieles schaffen es nicht mehr — der ganze Aufbau und Außenbau dieser Stücke läßt uns kalt, so wie alles, das wir nie erlebt, nie gelebt haben. Noch blickt das Publikum erstaunt, befremdet auf die Zauberei der edlen Fee, welche ihre letzte Perle für ihren Geliebten opfert — noch ist alles Spiel, im üblen Sinn von Spielerei — kein Spiel von Geist, nur ein Hokuspokus von Geistern —, schon aber beginnt die große Wandlung — mit sichtlicher Teilnahme und Ergriffenheit folgt das Publikum dem Lebensweg Flottwells, des „Verschwenders“ 1:
Diese überraschende Entwicklung ist nun keinesfalls allein auf die Tatsache zurückzuführen, daß die Schauspieler selbst erst allmählich im Laufe des Abends in ihre Rollen hineinwachsen — sie ruht vielmehr in der Herz und Sinn erwärmenden Entdeckung, welche die großen und kleinen Kinder, die der Vorstellung beiwohnen, sehr bald machen können: aus dem Wulst biedermeierlich-vormärzlicher Rhetorik und Gelehrsamkeit, aus dem Wust einer fatalen Zeithaftigkeit schält sich, zeitlos, unsterblich, ein menschlicher Kern, der allen Maskenwandel der Wienerstadt — von 1830 über 1848 und 1866, über 1918 und 1938 überdauert hat! Es ergeht den Raimundschen Kerngestalten im „Verschwender“ keineswegs so, wie Peer Gynt in der Begegnung mit dem mythischen Knopfgießer: dieser zerschält Peer Gynt symbolisch in der Gestalt einer Zwiebel — Hülle um Hülle, Schale um Schale fällt —, nichts bleibt! Ganz anders Raimunds treuer Diener Valentin und seine ganze Familie, zu der im tieferen Sinn, als der Familie der Menschen, Flottwell selbst von Anfang an gehört: diesejGestalten warten nur darauf, ihre Masken abzuwerfen, um zeitnah, ewig, dem beschämt und erfreut zuschauenden
Wiener : Publikum eine Lektion wienerischer Humanität verabreichen zu können! Diese Raimundschen Gestalten sind keine Helden
— eine Zeit, die an Gott glaubt, kennt keine „Helden“, diese (sie sind nicht zu verwechseln mit „Heroen“) gedeihen nur im Zwielicht des späten Mythos, auf der Bühne des sich selbst vergottenden Menschen. Raimunds Personen sind Menschen — geprägt mit allen Fehlern ihres Standes, ihrer Zeit, ihrer charakterlichen Eigenart —, Personen auch in eben dem Sinn, in dem man in Wien sagt: „Na, so eine Person ...“ Valentin ist zwar treu, aber auch lange genug ein Traumich-nicht, seine Frau ist zwar gut, das hindert sie jedoch nicht, oft recht ungut, herb, hart und zänkerisch zu sein, Flottwell ist zwar ein liebenswürdige?, anständiger Kerl, aber dabei eben auch ein Luftikus, „d e r Verschwender“. Selbst der Kammerdiener Wolf ist nicht nur, wie viele glauben, ein Theaterbösewicht, sondern ein von seiner Krankheit und das heißt von sich selbst, von seiner eigenen Schuld geplagter, leidender Mensch, mit dem deshalb der Bettler Flottwell Mitleid haben kann.
Dies aber ist es, was uns heute an Raimund ergreift: die unbedingte Wahrhaftigkeit dieser seiner Gestalten, die er uns in der ganzen Fülle ihres gebrechlichen und gerade deshalb so sorglich zu betreuenden Menschseins vor Augen führt. Hier erhebt er sich zu jener erhabenen Naivität, welche dem größten Schilderer des Natürlichen in unserem Raum, Stifter, eigen ist: mit dem „Verschwender“ rechtfertigt Raimund sein und der Wiener Menschentum von 1830 vor den späten Enkeln von 1947. Nicht mehr an ihm, an uns liegt es, die Echtheit und Unbedingt-heit unseres Menschseins vor den Augen der Vergangenheit und der Zukunft zu beweisen
— denn auch für uns kommt der Tag, an dem unsere Masken fallen — Stand, Kleid, Mode, Parteiabzeichen —, mögen wir dann so bestehen in der letzten Entscheidung unseres Lebens wie Raimunds Meister Valentin i n seinem Leben und vor seinem Tod.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!