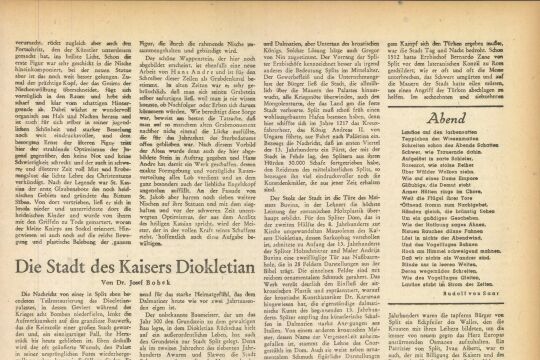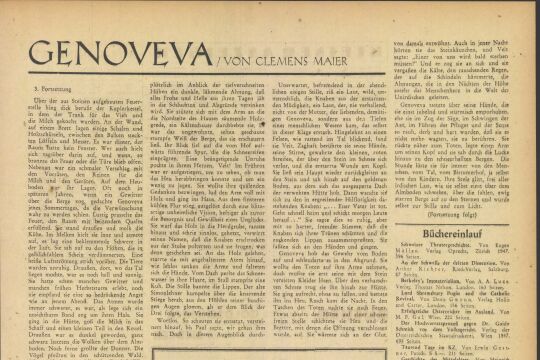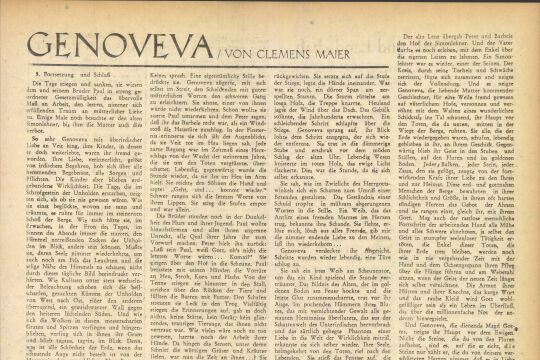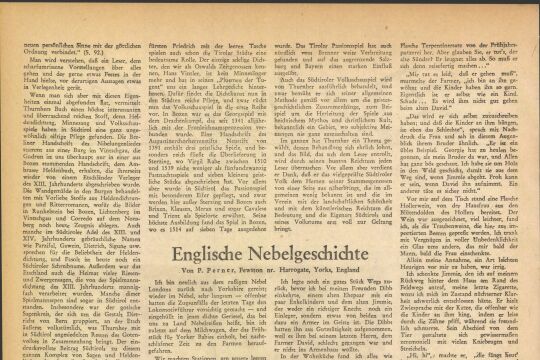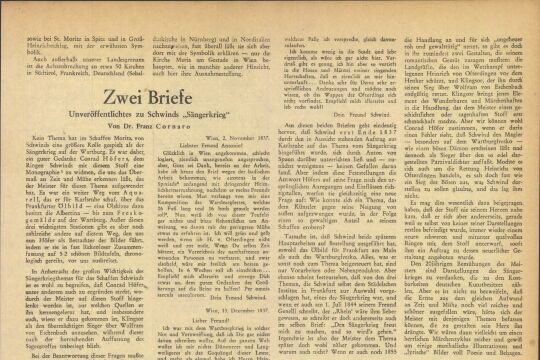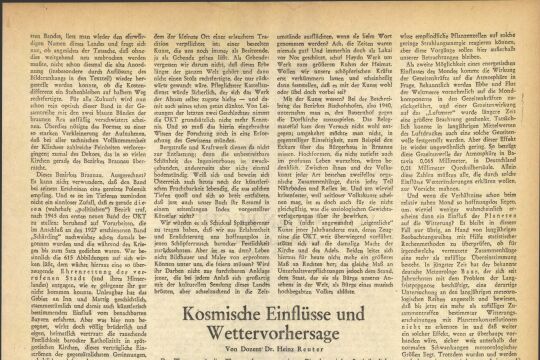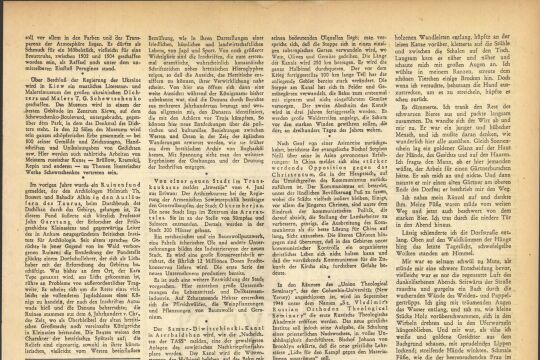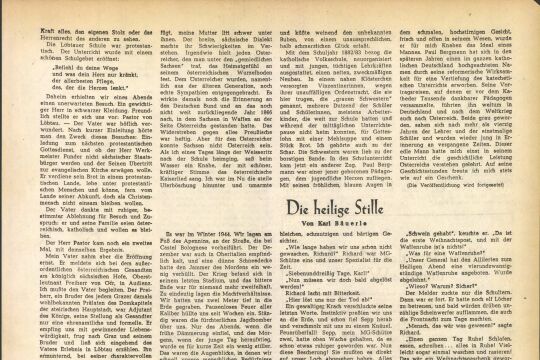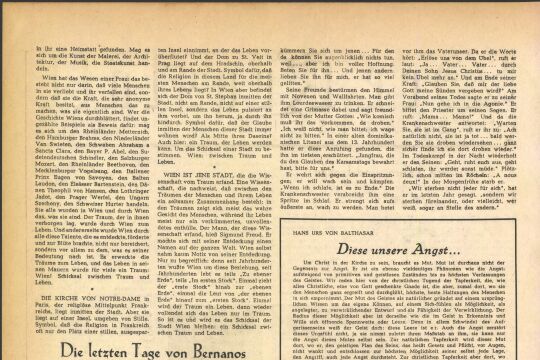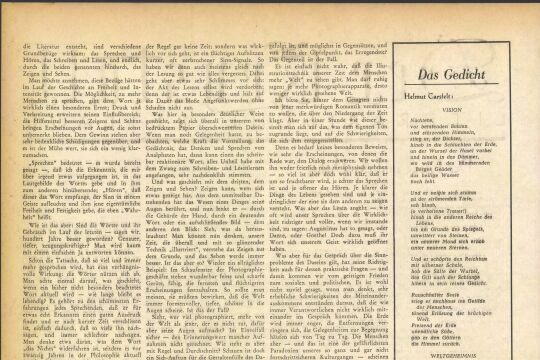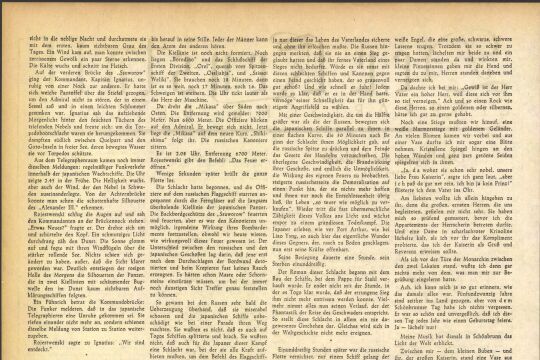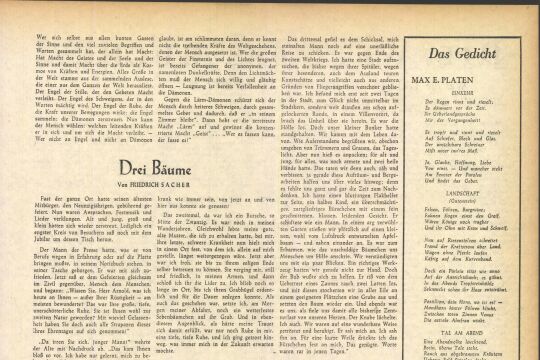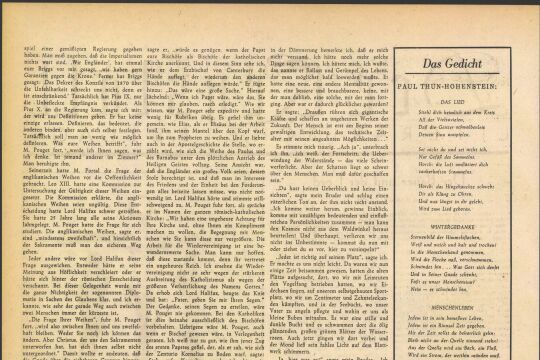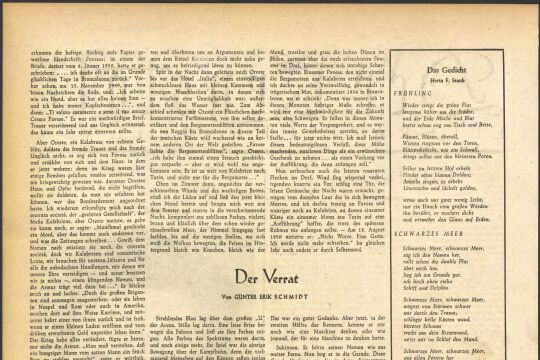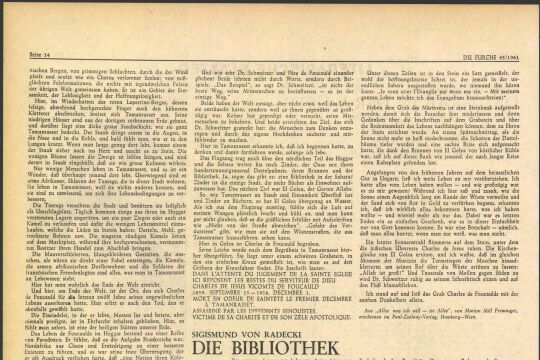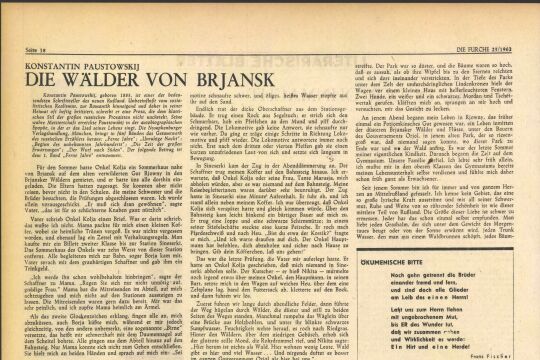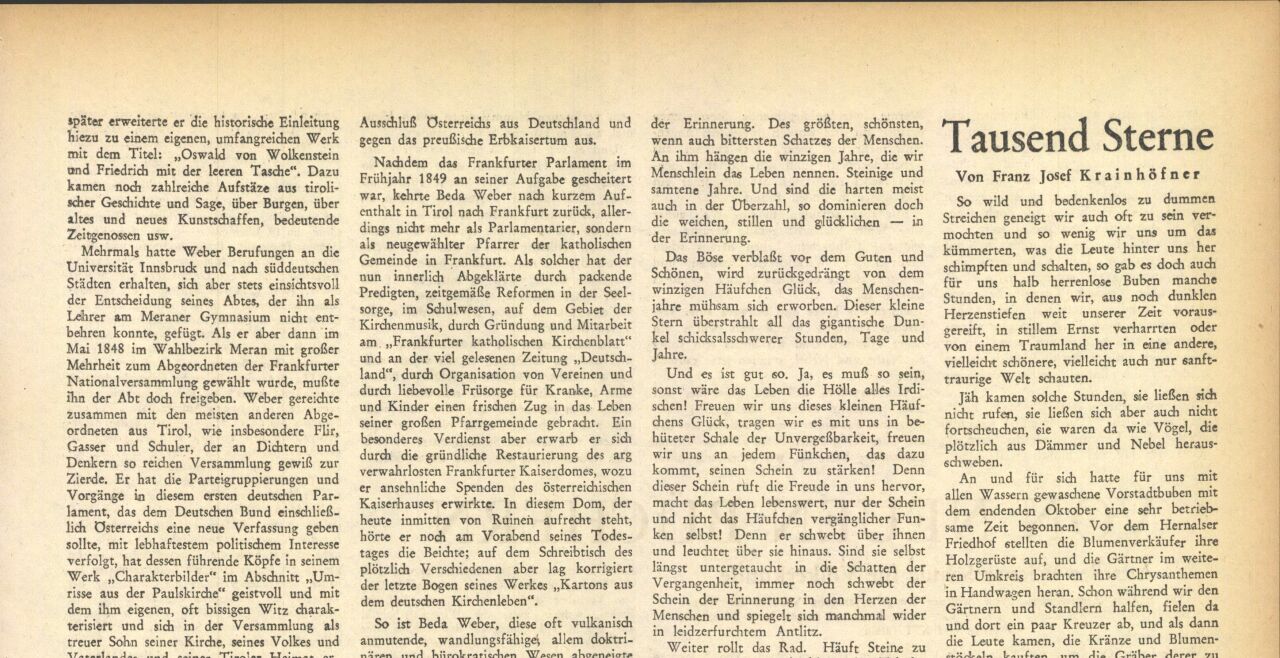
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Tausend Sterne
So wild und bedenkenlos zu dummen Streichen geneigt wir auch oft zu sein vermochten und so wenig wir uns um das kümmerten, was die Leute hinter uns her schimpften und schalten, so gab es doch auch für uns halb herrenlose Buben manche Stunden, in denen wir, aus noch dunklen Herzenstiefen weit unserer Zeit vorausgereift, in stillem Ernst verharrten oder von einem Traumland her in eine andere, vielleicht schönere, vielleicht auch nur sanfttraurige Welt schauten.
Jäh kamen solche Stunden, sie ließen sich nicht rufen, sie ließen sich aber auch nicht fortscheuchen, sie waren da wie Vögel, die plötzlich aus Dämmer und Nebel herausschweben.
An und für sich hatte für uns mit allen Wassern gewaschene Vorstadtbuben mit dem endenden Oktober eine sehr betriebsame Zeit begonnen. Vor dem Hernalser Friedhof stellten die Blumenverkäufer ihre Holzgerüste auf, und die Gärtner im weiteren Umkreis brachten ihre Chrysanthemen in Handwagen heran. Schon während wir den Gärtnern und Ständlern halfen, fielen da und dort ein paar Kreuzer ab, und als dann die Leute kamen, die Kränze und Blumenstöckeln kauften, um die Gräber derer zu schmücken, die ihnen gestorben waren, da fing so recht unsere Zeit an. Besonders die Blumenstöckel trugen die Leute nicht gerne selber, denn, da sie in der Regel schön angezogen waren, fürchteten sie, sich mit diesen die Kleider zu beschmutzen, und so hatten wir fast den ganzen Tag reichlich damit zu tun, den schön gekleideten Friedhofsbesuchern Blumenstöckel und auch größere Kränze bis zu den Gräbern ihrer Lieben hinzutragen.
Oft war es schon auch eine rechte Plage, denn die Chrysanthemenstöcke hatten ihr gutes Gewicht und die großen Kränze ließen sich auch nicht schlecht schleppen. Es kostete manchen Tropfen Schweiß, aber es brachte auch eine ganze Menge an Kreuzern ein.
Als es am Tage vor Allerheiligen Abend werden wollte, hatten wir jeder eine schwer anhängende Rocktasche voll von Kreuzern. Da beschlossen der Hansl, der Poldi und ich, für heute aufzuhören. Erstens waren wir rechtschaffen müde, zweitens hatten wir alle drei gut verdient, lAid drittens wollten wir von diesem Tag auch für uns selber noch etwas haben. Was wir haben wollten, das wußten wir nicht, auf jeden Fall aber sollte es etwas anderes sein, als Blumen oder Kränze schleppen. Daß wir zu diesem Zweck nicht nach Hause gehen wollten, darüber waren wir uns ebenfalls klar.
Weil wir uns aber nicht einig werden konnten, was wir mit diesem zu Ende gehenden Tag noch anfangen sollten, trabten wir nebeneinander langsam ein Stück die Aiszeile hinaus.
„Wollt ihr heute noch in den Wald hinausrennen?“ fragte Poldi plötzlich ärgerlich und blieb stehen.
Nun, eigentlich hatte er ja recht. Mit diesem Dahinlaufen wären wir in nicht allzu ferner Zeit tatsächlich in den Wald hinausgekommen. Dabei fing es schon stark zu dämmern an und von den Bergen herein wehte mit der späten Stunde ein dünner, aber alles verschleiernder Nebel.
Poldi setzte sich auf eine der hier in geringen Abständen zwischen den Alleebäumen aufgestellte Ruhebank und Hansl und ich taten das gleiche.
Nur durch die Straße und die drübere Baumreihe von uns getrennt, erhob sich die Friedhofsmauer. Auf sanftem Südhang, einst von Wein bestanden, rückten die endlosen Gräberreihen bis zum Hügelkamm hinauf. Der Nebel sank auf sie. Noch sah man als stärkere Schatten einzelne größere Grabmäler, Zypressengruppen und Trauerweiden, aber auch sie versanken in Nebel und Dämmer und bald lag uns gegenüber nichts mehr als Gestalt gewordene Sichtlosigkeit.
Für uns, die wir in der Gegend hier aufgewachsen waren, hatte der Friedhof nichts Schreckhaftes oder Unheimliches an sich. Wir hatten ein tiefes und noch nie erschüttertes Vertrauen zu dem Frieden der Toten und empfanden so etwas wie Freundschaft zu der Stille, die von ihnen kam.
Auch das Dunkel kam schon und drückte einen leeren Himmel tief herunter bis zu den Spitzen der längst kahl entblätterten Bäume. Die Stille war so vollkommen, daß wir unseren eigenen Atem überlaut hörten.
„Da schaut’s! Sogar heut kommt ein Stern!“ sagte Hansl, und obwohl es schon so dunkel geworden war, daß wir seine weisende Hand nicht mehr genau erkennen konnten, sahen Poldi und ich doch ebenfalls auf den ersten Blick diesen Stern.
Hoch stand er, gegen Norden zu, auf dem Hügelkamm. Und nicht ferne und kühl schimmerte er, sondern hatte einen weichen, fast goldenen Glanz. Er stand ganz ruhig und leuchtete warm und schön.
Da wir aber noch diesen einzigen, warmglühenden Stern betrachteten, stand jäh in seiner Nähe ein zweiter und gleich darauf ein dritter im immer tiefer werdenden Dunkel.
„Von wo kommen denn die Stern’ her?“ fragte Hansl leise. „Der Himmel ist ganz finster und es kommen doch die Stern’?!“
Und der Himmel blühte weiter auf.
Warme, wie goldleuchtende Sternblumen brachen auf und wurden mit jedem Augenblick mehr und mehr. Das Dunkel aus werdender Nacht und sich dichter brauendem Nebel sog diesen Sternschimmer ein und geriet in linden Brand.
Wir aber schauten in eine Welt außer aller Welt. Vielleicht gerade darum, weil wir aus frühhartem Leben heraus schon allzuviel an Wirklichkeit wußten und kannten, rührte uns diese Stunde besonders seltsam an.
Unter der Leere und Schwere eines verlorenen Himmels wurde und wuchs ein -neuer Himmel. Und wo nichts sein sollte als Nacht und Nebel, standen jetzt tausend Sterne.
Wir vergaßen, daß uns gegenüber auf sanft fallendem Südhang die großen Friedensstätte Tausender einst Friedloser lag, daß die Güte erinnernder Liebe zahllose Lichter angezündet hatte —, wir sahen nur unter dem verlorenen Himmel einen neuen Himmel, an dem tausend Sterne standen.
Und es war uns, als gehörten wir selber auch diesem Himmel zu, denn er war so nahe, das Licht seiner Sterne rührte als leiser, fast spürbar wärmender Schein an uns; wir atmeten hinein in ihn — — In diesem Augenblick sprach Hansl ganz leise und vielleicht allein zu sich selber dieses Wort, das ich nie vergessen habe und nie vergessen werde, weil es mir, so oft ich mich seiner entsinne, so wohl und so weh zugleich tut. Er sagte; „Wie schön es die Toten doch haben.“
Hernach fingen die tausend Sterne nach und nach zu verlöschen an. Es wurde endgültig Nacht. Undurchdringlicher Nebel. Alle Liebe schien wieder erloschen. Wir saßen noch immer auf der Bank und wußten nicht, ob wir nicht bloß geträumt hatten: von tausend Sternen unter verlorenem Himmel, die die Liebe angezündet.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!