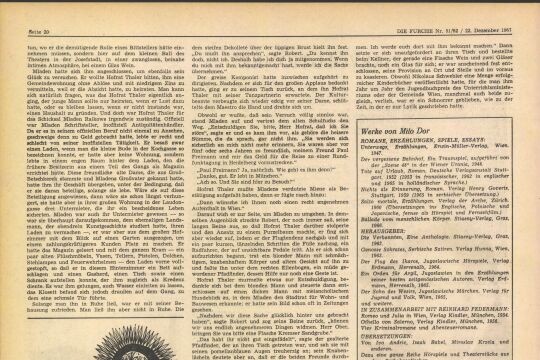Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
„Therese Raquin"
Als Beitrag zu den Wiener Festwochen präsentiert das „Theater der Courage" Emile Zolas pränaturalistische „Therese Raqui n“, die angeblich noch immer aktuell sein soll. Die Aufführung überzeugte vom Gegenteil. Gewiß, die Fabel trägt ein Stück und ist im einzelnen durchaus glaubwürdig, wird aber von Zola, dem es nicht um Verlebendigung, sondern um Analyse, wie sie „Chirurgen bei Leichnamen machen", ging, so exakt und mit so offensichtlicher Logik vorgeführt, daß die handelnden Personen nicht ihrem Impuls, sondern der Hand eines übermächtigen Schicksals — alias Emile Zola — zu folgeu scheinen. Die Szenen-führung ist ruckartig wie das Einschieben und Auswechseln von Diapositiven, die Konsequenzen erweisen sich als konstruiert und grobschlächtig. Hier hat der „Zahn der Zeit" ganze Arbeit geleistet. Edwin Zbonek fiel die unangenehme Aufgabe zu, dieses „benagte" Stück zu inszenieren. Seine Neigung, Dialoge zq verbreitern, zu verschleppen, half ihm diesmal, die unorganisch verknappte Abfolge von Ehebruch, Gattenmord, Schrecklähmung, Angst und Haß erträglich zu machen. Interessanterweise unterscheidet die „Courage“ im Programmheft bei der Premierenvorschau für 1954 55 zwischen „modernen Dichtungen“ und „österreichischen Stücken“. Wehmütig pflichtet der Leser bei.
August Defresnes erfolgreiches Schauspiel um die heilende Kraft der „entfesselten“ Phantasie ist nun doch noch, allerdings mit hierorts üblicher Verspätung, in Wien aufgeführt worden. Dem Kleinen Theater im Konzerthaus gelang damit ein zweites, verblüffendes Husarenstück. (Das erste, Kaisers „Soldat Tanaka", ist noch frisch im Gedächtnis.) Der holländische Im port rechtfertigte den guten Ruf, der ihm vorausging, in jeder Weise. Eine originale Bühnendichtung, in der Nähe des Volksstückes zu Hause, geschickt im Aufbau, suggestiv in der Wirkung, Klippen allzu sentimentaler Details geschickt ausbiegend, bevor sie gefährlich werden können. Defresne erwartet viel, nein: alles, von der Phantasie. Das „unbewohnte Eiland“, zu dem sie entführt. ist kein Orplid, kein Utopia schwerelosen Glücks, sondern ein Ort der Wahrheit. Wer ihn betritt, wird schmerzhaft bloßgestellt. Das Vorgegebene fällt ab. Am „Hartjesdag" irgendeines Jahres besucht der „alte Herr“ ein Amsterdamer Volkslogierhaus. Sechs gescheiterte Existenzen findet er dort, die sich gegenseitig das Leben zur Hölje machen. Liebenswürdig lädt er sie zu einer Reise nach dem „unbewohnten Eiland“ ein, improvisiert aus umgestürzten Tischen, Stühlen, Besen und Tüchern eine Barke, auf der die Passagiere lachend und kopfschüttelnd Platz nehmen. Sie halten ihn für einen Verrückten. Bald aber werden sie selbst verrückt. Die Phantasie tut ihre Wirkung. Der eisige Wind der Wahrheit beginnt zu wehen. Der Wirt des Logierhauses entdeckt eine frühe Liebschaft seiner Frau. Eine Heilsarmeeschwester begreift, daß ihre Bekehrungsversuche nicht religiöser Begeisterung entsprangen, vielmehr gehemmter Erotik. Der verbummelte Student „Slappe“ erlebt den Niederbruch seiner kunstvoll konstruierten „Philosophie der Gleichgültigkeit“. Doch nicht mir die Schuld wird sichtbar, auch die unmerklich durch Jahre fortblutende Wunde der Einsamkeit, der Sehnsucht nach Verständnis, der unbeantworteten Liebe. Je ungeschminkter sich die sechs gegenüberstehen, desto gerechtfertigter erscheinen sie, und unwillkürlich erinnert man sich an Weinhebers: „Schuld, die da Worte gefunden, ist schon im Geist überwunden." Der „alte Herr" verläßt das Logierhaus — zurück bleiben die Verwandelten, bereit, „die kurze Zeit, die uns zugemessen ist“, besser, das heißt nach Defresne: zu Arbeit, Ruhe und Zufriedenheit zu nützen.
Die Aufführung des Stückes, das merkwürdig anspruchsvoll und anspruchslos zu gleicher Zeit ist, hatte Niveau. Ein erfreulich homogenes Ensemble!
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!