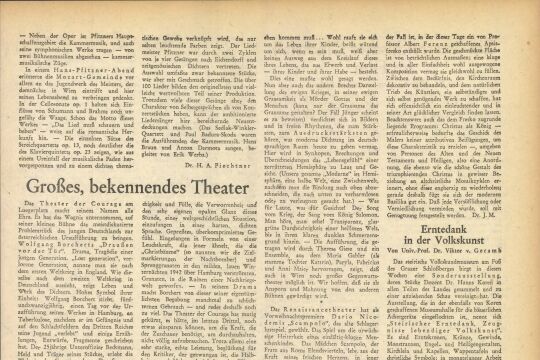Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Tragik . direkt und verschlüsselt
Wer das Publikum seiner Zeit erschüttern, aufrütteln oder auch nur /um Nachdenken bringen will, muß die Wellenlänge kennen, die für die jeweilige Generation aufnehmbar ist. Karl Schönherr schrieb sein Trauerspiel „Frau Suitner” für Menschen, die eine starke Dosis direkter Gefühlsaussage vertrugen, ja verlangten. Er war Arzt und schien genau gewußt zu haben, was die Anweisung „quantum satis” auf einem Rezept bedeutet. Bei ihm geschieht immer genau das, wird immer genau das gesagt, was dramaturgisch und inhaltlich unbedingt nötig ist. Das Mehr, die problematische Infragestellung, die Schattierung des Beiwerks: das alles fehlt. Das alles wollte er nicht. Die Geschichte der kinderlosen Frau Suitner, das tragische Scheitern einer Ehe, die nichts sein soll als „Egoismus zu zweit”, wird folgerichtig abgewickelt. Der Gegenpol wird dort aufgebaut, wo er logisch hingehört: bei der Fruchtbarkeit, dem nicht nach dem Morgen sorgenden blühenden Leben. (Gerade da wird das Stück für uns problematisch.) Aber bühnenwirksam war diese holzschnitthafte Antiethik ohne Zweifel. Bühnenwirksam war auch Gustav Mankers Inszenierung am Volkstheater, weil sie historisch blieb (wie das mit Recht konsequent naturalistische Bühnenbild Willi Bahners) und ganz einfach Theater spielen ließ, hinter der aufgezogenen „vierten Wand” des Guckkastens, ohne den hier gewiß zum Scheitern verurteilten Versuch, das Publikum von heute direkt anzusprechen. Ein großer künstlerischer Akzent: Dorothea N e f f, bei ihrer Wiederkehr stürmisch bejubelt, als Frau Suitner. Nicht frei von Manier, die ihm die eigenen, natürlichen Töne zeitweise verdirbt, der Gatte Otto Wögeiers. Die fruchtbare Magd gab Hilde Sochor mit einer inneren (wienerischen) Dialektechtheit, die prächtig überzeugte. Eine ausgezeichnete Episode: die keifende Magd der Martha Hartmann.
Der Spanier Alfonso Paso sagt seine keinesfalls harmlose Meinung über Ehe und Lebenslüge nicht nur deshalb indirekt, weil er in Franco-Spanien lebt. Er kennt seinen Priestley und seine Cocktailparty von Elliot. Und er weiß, daß man die Menschen von heute erst sehr behutsam plaudernd anlocken muß, wenn man ihnen bittere Wahrheiten sagen will. Die Spanier sind keine Moralisten, schon gar nicht in der Erotik. Ihre Moral bewegt sich in harten, den wirklichen Menschen immer wieder schmerzhaft auseinanderreißenden Extremen: Sünde und Geständnis, Daseinslust und Lebensekel. Das alles spürt man als ein sehr herbes Aroma bei seinem in der Josefstadt erstaufgeführten Stück „Weekend - Party”. Manches ist vielleicht etwas konventionell konstruiert, allzu lang ausgesponnen, aber dennoch:, ein sehr eigener, unverwechselbarer Ton ist da. Edwin Z boneks Regie bemühte sich, ihn wenigstens zeitweise hören zu machen. Das war natürlich immer dann der Fall, wenn Leopold Rudolf sprach. Er ist der spanische Gregor Werle, der zerbrochene und zerbrechende Don Quijote dieses Stückes, und spielt vollendet. Von den Partnerinnen und Partnern seien Peter Gerhard, besonders aber die im Ton sichere Eva Kerbler und die wie immer ausdrucksstarke, hier vielleicht einen Dämpfer vertragende Elfriede Ott hervorgehoben.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!