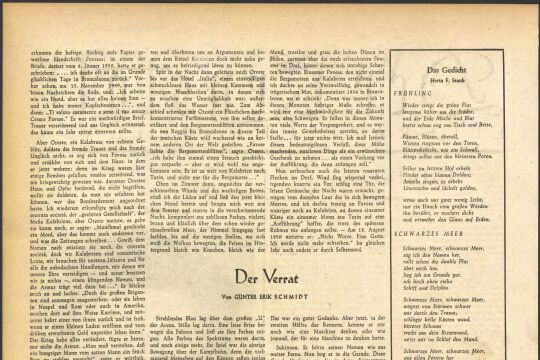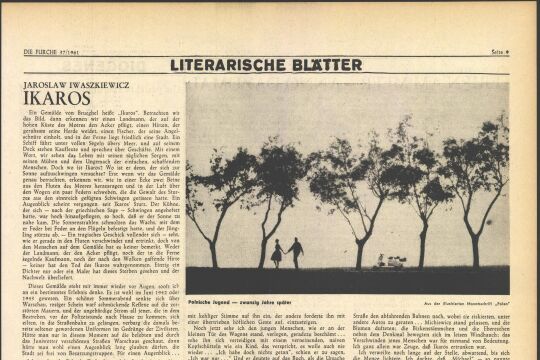Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Der Jüngling und „die Krankheit zum Tode“
Auf der Straßenbahn traf ich ab und zu einen jungen Mann von etwa achtzehn Jahren. Er mußte in keinen guten Verhältnissen leben, denn seine Schuhe waren vertreten und die Hose war alt. Das Auffälligste aber an ihm war, daß er die längsten Haare trug, die ich je, auch in unserer an langen Haaren keineswegs armen Zeit, an einem Burschen gesehen habe. Leicht gewellt und braun fielen sie, immer dichter werdend, bis ins Genick hinab, wo sie beinahe, wie bei den Mädchen, in einer aufgedrehten Rolle end'gten. Ich war nicht der einzige, der ihn beobachtete, sondern jeder, der ihn sah, verharrte eine Weile bei seinem Anblick, ehe er weiterging. Zuerst ging er immer in der Schar, obwohl er nicht so stark hervortrat wie die ändern. Er machte keine lauten Witze, er war zurückhaltend und erschien nachdenklich und verträumt. Es schien, als warte er auf etwas, und die langen Haare trug er wie ein Schicksal.
Als es vor Weihnachten einmal ziemlich kalt war, stürmte die ganz Bande den Straßenbahnwagen, als Letzter kam er. Kein einziger von ihnen hatte einen Mantel, die meisten trugen über dem armseligen Hemd gleich den Rock, ihre Hosen waren zerfranst, aber ihre Unterhaltung füllte den ganzen Wagen. Sie hatten sich in einem ändern Bezirk einen neuen Film angesehen und wiederholten jetzt das Gesehene und machten einander auf die Pointen aufmerksam. Das füllte sie so aus, daß sie anscheinend die Kälte gar nicht spürten. Der Langhaarige hörte nur zu, wie die ändern lachten.
Wenn von unserer Jugend die Rede war, dachte ich immer an diesen Burschen, und sein melancholischer, ins Weite irrender Blick ließ mich nicht los.
„Traurigkeit einer verlorenen Generation?“ fragte ich mich. „Sind sie einfach Opfer, die dem Moloch Zeit in den Rachen geworfen werden? Was geht in ihren Herzen vor? Gibt es keine Brücken zu ihnen?“ Es gehört mit zur Tragik dieses Lebensalters, daß man es vergißt, wenn man es einmal glücklich hinter sich gebracht hat. Vielleicht aber war keine Jugend schwerer u verstehen als die jetzige, doch begehen wir, wenn wir so forschend vor sie treten und ihr auf den Grund kommen wollen, einen Fehler. Wir vermuten ganz komplizierte Vorgänge in ihren Herzen. Wenn wir ihnen wirklich nähertreten, erkennen wir, daß ie überhaupt keinen bestimmten inneren Gehalt haben. Eine unendliche Leere gähnt einem an. Es fehlt einfach so vieles, das, was da sein sollte. Was wir sehen und an was wir uns stoßen, sind hilflose Gesten, die gar nicht charakteristisch sind. Schlurf, Schwarzer Markt und Swing, das ist ein zufälliges, aus Verlegenheit übergeworfenes Kleid. Diese jungen Menschen haben kein Geheimnis, das wir enträtseln müssen. Leute, die von Berufs wegen mit ihnen viel zu tun h bcn, Erzieher und Kriminalisten, können das bestätigen. Man könnte meinen, die leere Stätte ihres Herzens sei den Dämonen preisgegeben und diese würden ihnen ihr Gesidit aufprägen, aber das ist merkwürdigerweise noch nidit geschehen. Unsere Jungen sind im Grunde alle harmlose Burschen, auch die schlimmsten machen keine Ausnahme. Es ist zum Staunen, wie viel Unverbrauchtes noch in den Schlechtesten steckt. Sie stehen zwischen Gut und Böse. Das ist ihr Unglück, aber vielleicht auch ihr Glück.
Doch idi wollte von meinem Freunde weiter erzählen. Ich hatte ihn längere Zeit nicht gesehen. In der vorigen Woche begegnet ich ihm wieder, aber er war kaum zu erkennen: seine Haare waren geschnitten, er trug sie wohl noch zurückgekämmt, aber nicht übertrieben. Sein Kopf war dadurch beweglicher, er brauchte-ihn nicht mehr so starr und vorsichtig tragen. Die Stirne wirkte sehr hoch. Die Schuhe waren noch dieselben. Hut trug er keinen. Die Hose erschien gepflegter, und das Wichtigste, er hatte einen übertragenen, aber noch sehr netten Mantel an. Von einem Anhang war nichts zu sehen. In der Hand hielt er ein Buch, das den Namen einer Leihbücherei trug. Gern hätte ich gewußt, was er las, aber es war nicht leicht herauszubringen. Er las immer nur wenige Sätze, blätterte, sah überlegend in die Weite und las wieder ein Stück. Endlich ließ er das offene Buch in den Schoß sinken, und ich erkannte an der Zierleiste einer Überschrift, daß e ein Diederidis-Buch war. Da stand ich auf und trat näher. Kein Zweifel, es war „Die Krankheit zum Tode" von Sören Kierkegaard. Ich hatte das gleiche Buch erst vor einigen Tagen in der Hand gehabt. Mit der Krankheit zum Tode ist die Verzweiflung gemeint. Es ist eines der wenigen wesentlichen Bücher, das gerade jetzt von höchster geistiger Aktualität ist. Es zeigt die Krise im Menschen, die Entscheidung und den Weg in die Zukunft.
Wie war er nur daraufgek’ömmen? Hatte er irgendwo einen Hinweis gelesen oder verkehrte er jetzt in einer anderen Gesellschaft? Ich sah ihn mit anderen Augen an. Wenn einer sich die Haare schneiden läßt, aus der Schar ausspringt und Kierkegaard zu lesen beginnt, ganz gleich wieviel er davon versteht, dann ist er ein anderer Mensch geworden oder ‘zumindestens ist er in eine neue Straße eingebogen.
Oh, unerschöpfliche Natur der Jugend, die zu immer neuen Aufbrüchen fähig ist!
Um seine Augen lag etwas Weiches, die Brauen umrahmten sie schwärmerisch. Ewiger Jüngling, dachte ich. So waren wir gewesen, so waren die Romantiker, so waten die jungen Menschen zu allen Zeiten, wenn sie der Genius berührte. In meiner Freude fragte ich einen Bekannten, der mit mir fuhr: „Herr Oberlehrer, ist Ihnen der junge, lesende Mann da drüben aufgefallen?“ „Nein."
„Das ist derselbe, der früher die überaus langen Haare trug. Sie kannten ihn doch?“ „Natürlich."
„Wissen Sie, was er liest?“
„Einen Schundroman.“
„Nein, die ,Krankheit zum Tode'.“ „Unmöglich.“
Ich überzeugte ihn. Er kannte das Budi,
weil er ein guter Freund des verstorbenen großen Wiener Lehrerphilosophen F. Ebner gewesen war.
„Den Mann müssen wir uns näher an- sehen“, sagte er.
Da kam eine Haltestelle und der Jüngling verschwand im Gedränge.
Ein Pessimist kann sagen: Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Das ist richtig, aber sie zeigt den kommenden Sommer an.
Ich glaube, mein verwandelter Jüngling zeigt auch etwas an, nämlich dieses, daß er zu keiner verlorenen Generation gehört, sondern daß neue und schöne Wege vor ihnen liegen und daß sie zu neuen Aufbrü- chen fähig sind.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!