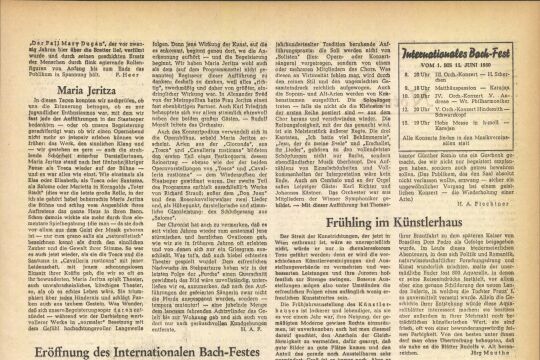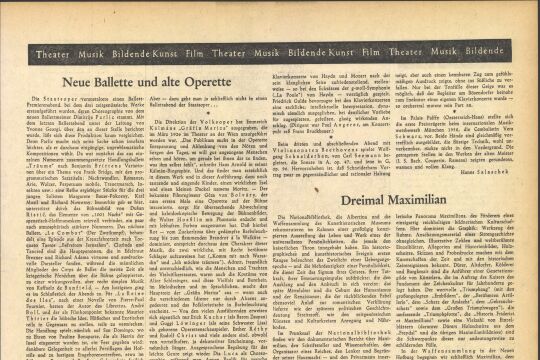Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Belsazar, Atmospheres
Das Oratorium Belsazar von Händel entstand 1744, zwischen den großen Erfolgsstücken dieses Genres („Messias“, 1741, und „Judas Maccabäus“, 1747) und konnte sich trotz des dramatischen Inhalts weder spontan noch auf Dauer recht durchsetzen. Das weitschweifige Textbuch (das Händel ohnehin um 200 Zeilen kürzte) und die dadurch bedingten langen Rezitative mögen daran schuld sein, keinesfalls die herrlichen Arien und die zügigen, charakterisierenden Chöre. Die Wiedergabe des Werkes unter Karl Richter (Symphoniker, Singverein) ging leider auch am großen Erfolg vorbei, obwohl Chor und Solisten einwandfreie Leistungen boten. Unter letzteren traf Lotte Schädle (Sopran) als Belsazars Mutter den Ton ihrer Rolle am besten und innerlichsten. Herta Topper, (Mezzosopran) in der Partie des jungen Cyrus war mit ihrer warmen Altstimme gelegentlich im Gegensatz zum draufgängerischen Perserfürsten. Anton Dermota bemühte sich mit Erfolg um die tenorale Verkörperung des Belsazar, John Shirletf-Quirk war ein überzeugender Gobrias (Baß) und Christian Boesčh (Baß) als Daniel eine Entdeckung. Im Orchester sind diesmal nur die Bläser (Trompeten!) besonders hervorzuheben. An der nicht immer präsenten Präzision der Streicher mag auch das etwas fahrige und improvisiert anmutende Einsatzgeben des Dirigenten seinen Anteil haben, der zwischen Dirigentenstab und zweitem Cembalo fast willkürlich wechselte und dadurch ein Gefühl der Unruhe und manchmal der Unsicherheit erzeugte. Auf weite Strecken fehlte die naturbedingte Steigerung, so daß man den Eindruck gewann, eine weitere Kürzung wäre von Vorteil gewesen. Das Publikum war trotzdem dankbar und applaudierte begeistert. ’
Im 3. Abonnementkonzert der Philharmoniker gab es im ersten Teil zwischen einem Concerto grosso von Händel und einem schwungvoll und farbenprächtig musizierten „Carnaval Romain“ von Berlioz eine Wiener Erstaufführung. Warum man Händel in so kleiner Besetzung (zwei Kontrabässe) und so klangasketisch spielte? Gewiß, das a-Moll-Konzert gehört nicht zu den stärksten Stük- ken des großen Meisters, aber ganz do spannungslos hätte es nicht zu sein brauchen. — „Atmosphėres“ des in Wien lebenden Ungarn György Ligeti wurde bereits 1961 geschrieben, ein Jahr später in Donaueschingen uraufgeführt und in vielen Musikstädten nachgespielt. Überall fand es, wenn nicht Zustimmung, so doch Anerkennung als ein virtuos gemachtes und apartes Stück. Dieses 9-Minuten-Werk stellt wirklich etwas Neues dar. Mit einem großen Orchester ohne Schlagwerk bringt Ligeti merkwürdige immaterielle Klänge hervor, es gibt weder markante Rhythmen noch melodische Elemente, sondern nur Farben (verschiedene Nuancen von Grau) innerhalb eines diffusen Klangbildes. Auch entbehrt das Stück, trotz seines statischen Charakters, nicht einer gewissen inneren Dramatik, zumindest eines dramatischen Höhepunktes: wenn einem gewaltigen Crescendo (der Tonstärke und -höhe), das in einem schneidend hohen Ton kulminiert, plötzlich, im ppp, das tiefe Rumoren der Streicher antwortet. Es gibt Klänge in diesem Stück, deren Quelle schwer zu identifizieren ist, und der Referent gibt gerne zu, daß er sich wiederholt nach einem vielleicht doch irgendwo versteckten Schlaginstrument, etwa einer kleinen Trommel mit Stahlbesen, umgesehen hat. Aber es waren nur die Streicher, die dieses zischende, wischend-wis- pennde Geräusch hervorgebracht haben. Das Publikum hat sich für das Stück interessiert und den anwesenden Komponisten, das Orchester und den Dirigenten mit lebhaftem Beifall bedacht.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!