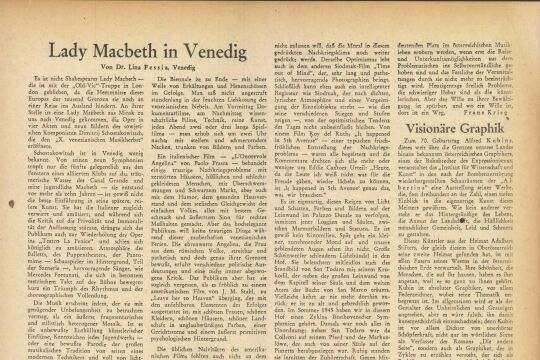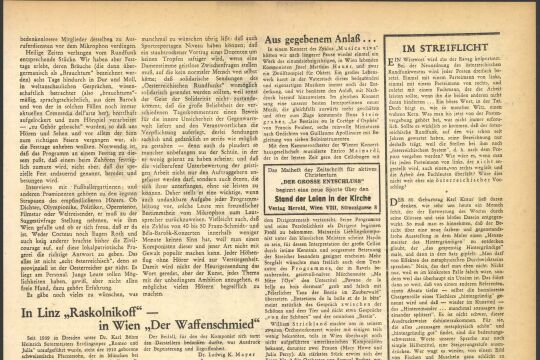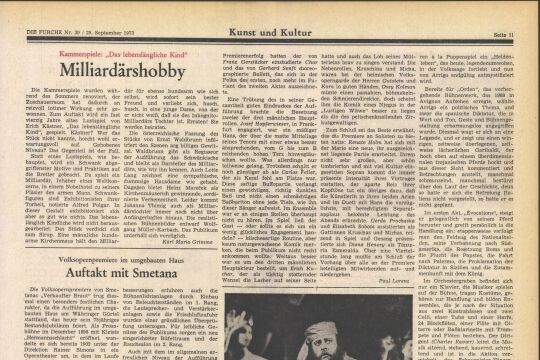Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die schreckliche Lady
„Macbeth“, 1847 im Pergola-Theater von Florenz uraufgeführt, steht in der Reihe der Jugendwerke Verdis an zehnter Stelle und unmittelbar vor den „Räubern* und der Trias „Rigoletto“, „Troubadour“ und „Traviata“. Über diese etwa gleichzeitig mit dem „Lohengrin“ entstandene Oper schrieb vor 35 Jahren der ausgezeichnete Münchener Musikkritiker Alexander Berrsche, der ein großer Verdi-Verehrer war: „Gewiß ist der Librettist Francesco Maria Piave mit Shakespeare umgegangen wie ein Seeräuber, und gewiß hat der junge Verdi manchmal sogar das noch totgeschlagen, was selbst der Seeräuber geschont hat.Wenn es im ersten Hexenchor nach D-Dur geht oder wenn die Mörder Banquos im Pianissimo und Staccato ihren Mörderchor anstimmen, so beginnt ein Musizieren, dessen unverwüstliche Komik nur noch von dem Humor des Gegensatzes zwischen Ton und Wort übertroffen, aber von keiner Parodie mehr erreicht werden kann. Hier wird so ungeheuerlich, so naiv danebengehauen, aber zugleich in so großem und volkstümlichem Stil, daß man darüber keiner anderen Empfindung fähig ist als einer unbezähmbaren Heiterkeit, einer Heiterkeit ohne jeden Tropfen Gift, die sich mit Achtung und Liebe ausgezeichnet verträgt.“
„Macbeth“, 1847 im Pergola-Theater von Florenz uraufgeführt, steht in der Reihe der Jugendwerke Verdis an zehnter Stelle und unmittelbar vor den „Räubern* und der Trias „Rigoletto“, „Troubadour“ und „Traviata“. Über diese etwa gleichzeitig mit dem „Lohengrin“ entstandene Oper schrieb vor 35 Jahren der ausgezeichnete Münchener Musikkritiker Alexander Berrsche, der ein großer Verdi-Verehrer war: „Gewiß ist der Librettist Francesco Maria Piave mit Shakespeare umgegangen wie ein Seeräuber, und gewiß hat der junge Verdi manchmal sogar das noch totgeschlagen, was selbst der Seeräuber geschont hat.Wenn es im ersten Hexenchor nach D-Dur geht oder wenn die Mörder Banquos im Pianissimo und Staccato ihren Mörderchor anstimmen, so beginnt ein Musizieren, dessen unverwüstliche Komik nur noch von dem Humor des Gegensatzes zwischen Ton und Wort übertroffen, aber von keiner Parodie mehr erreicht werden kann. Hier wird so ungeheuerlich, so naiv danebengehauen, aber zugleich in so großem und volkstümlichem Stil, daß man darüber keiner anderen Empfindung fähig ist als einer unbezähmbaren Heiterkeit, einer Heiterkeit ohne jeden Tropfen Gift, die sich mit Achtung und Liebe ausgezeichnet verträgt.“
Berrsche meint, daß der Gegensatz zwischen dem Sujet und seiner Darstellung nicht übertroffen werden könne. Aber er hat die Inszenierung Otto Schenks in der Wiener Staatsoper nicht gesehen. (Diejenige, welche Schenk und der Bühnenbildner Rudolf Heinrich in München machten, soll „abstrakter und stilisierter“ gewesen sein.) Die beiden sehr vordergründigen und primitiven Hexenszenen, das blutige Messer erst in der Lady, dann in Macbeths genußvoll angeleuchteten, blutigroten Händen, der aus Orgelpfeifen bestehende Hintergrund einiger Szenen, Banquos Erscheinung auf dem Banquett, ebenfalls blutigrot, der aus einem Gruselkabinett zu stammen schien, die Mörderszene wie auf einer altmodischen Schmiere, das stimmungslose Nachtwandeln der Lady Macbeth, schließlich der als Wald von Birnam völlig phantasielos getarnte feindliche Kriegerhaufen: all das verteidigte Schenk in einem Fernsehinterview als „romantisch und realistisch“, während „das Münchner Augenmerk auf die schaurige Klarheit gerichtet war“ (!). Nun, schaurig-klar war auch das Fehlen eines Regiekonzepts der Wiener Inszenierung, dem die vieles vertuschende, freilich auch sehr ermüdende Dunkelheit zustatten kam. Die Kostüme von Hill Reihs-Gromes waren unauffällig und fügten sich gut ins nicht vorhandene Gesamtkonzept. — In dem bereits erwähnten TV-Gespräch erinnerte Dr. Karl Böhm an seine erste „Mac-beth“-Interpretation, die im Jahre 1933 in Hamburg stattfand. Über Shakespeare, Piave, die Musik Verdis und andere künstlerische relevante Fragen — kein Wort; nur daß er damals andere Tempi genommen habe, die er, vor allem Christa Ludwig zuliebe, jetzt geändert hat...
Unter dem Gesichtspunkt einer Sänger-Oper für Belcantofans betrachtet, war an diesem Abend freilich einiges geboten. Christa Ludwig sang die Partie der schrecklichen Lady, der mörderischen Managerin, mit vollendetem Wohllaut, dramatischer Kraft und beträchtlicher Virtuosität. Von ihr war die „rauhe, erstickte, hohle Stimme“, die Verdi sich wünschte und die man wohl auch nicht künstlich produzieren kann, nicht zu erwarten; lediglich etwas mehr schärfere Charakterisierung und härteren Ausdruck hätte man sich stellenweise gewünscht. Ihr zur Seite, ebenbürtig (und das will etwas heißen) der junge amerikanische Bariton Sherrill Milnes, von dem man bei uns zum ersten Mal anläßlich eines Gastspiels an der Scala gehört hatte. Er besitzt die schönste Stimme, die man sich vorstellen kann, von edlem Timbre, gleichmäßig in allen Lagen, stark und ausdrucksvoll. Und er ist ein intelligenter, gutaussehender Schauspieler, dessen Intensität sich im Laufe des Abends eher steigerte als abschwächte. Die wichtigen Nebenrollen waren mit Karl Ridderbusch, Ewald Aichberger und Carlo Cos-sutta gut bis mittelmäßig besetzt.Vorzüglich studiert war der Chor, aber die Grenze vom ff-Singen zu häßlichem Schreien wurde mehr als einmal überschritten. Erstaunlich, daß Dr. Böhm das duldete, der diese abenteuerliche Partitur mit den Philharmonikern mehr auf Schönklang als auf Charakteristik interpretierte. Langanhaltender und sehr lebhafter Beifall für alle Beteiligten. Die Protagonisten Christa Ludwig und Sherrill Milnes waren während des langen Abends fast nach jeder ihrer Arien beklatscht worden.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!