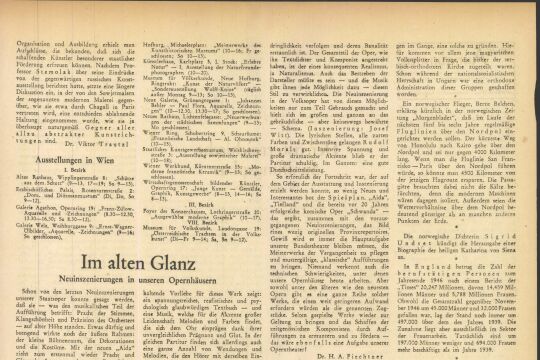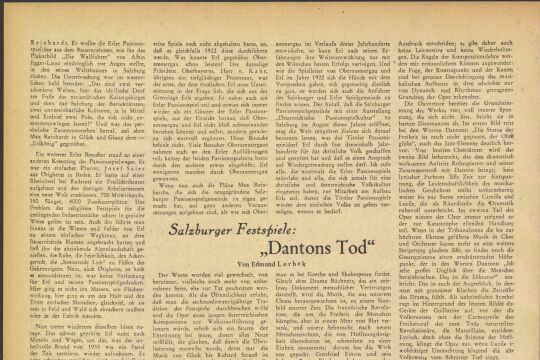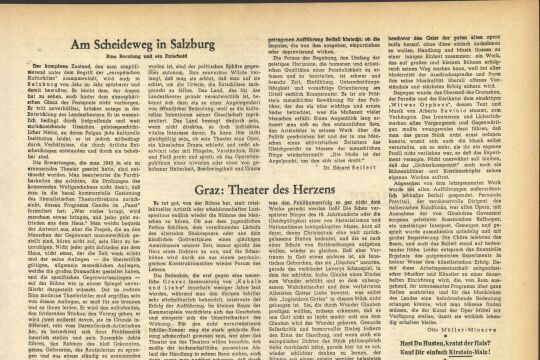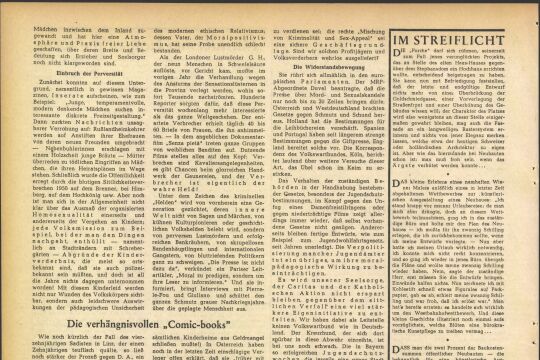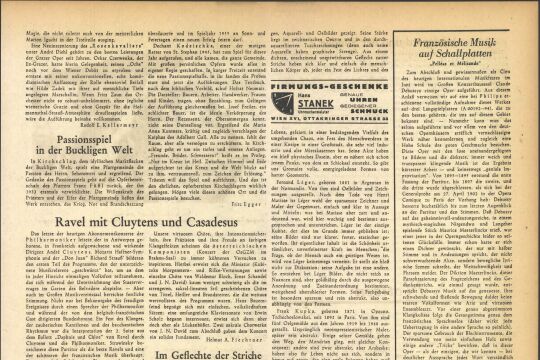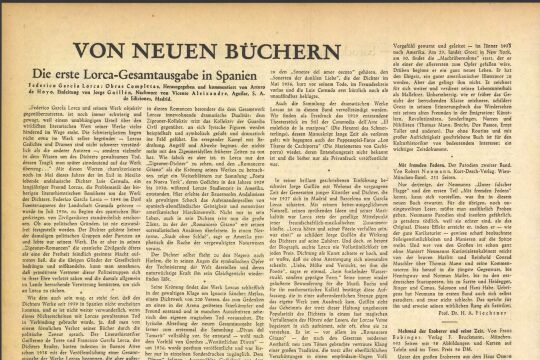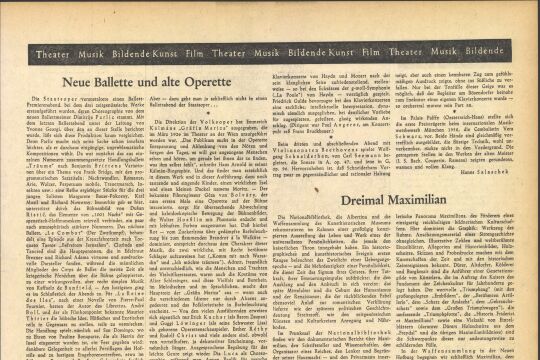Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Wolfgang Fortners „Bluthochzeit“
Im Abstand von zwei Tagen brachten zwei Bühnen des deutschen Sprachbereichs Uraufführungen von Opern heraus, die den ganzen weiten Raum des modernen Musiktheaters abgrenzen. Zwischen der oratorienhaften Konzeption von Arnold Schönbergs „Moses und Aron“ und Wolfgang Fortners musikalischer Deutung des Dramas „Bluthochzeit“ von Federico Garcia Lorca liegt ein Gaurisankar stilistischer und technischer Unterschiede. Und doch führen beide Werke der Opernbühne ähnliche Mittel der Erneuerung im Vokalstil zu.
Fortner vermeidet den Namen Oper. Tatsächlich ist es sozusagen als Kristallisationsprozeß aus der Beschäftigung mit Garcia Lorcas lyrischer Tragödie entstanden. Vor Jahren hatte Fortner für Barlogs Steglitzer Schloßparktheater eine Bühnenmusik dazu geschrieben. 1953 wurde in Essen ein Fragment „Der Wald" aufgeführt, das auf die entstehende Komposition hinwies. Und nun hat Köln in seinem wohlproportionierten, akustisch prachtvollen Opernhaus die Uraufführung gezeigt.
In dieser Partitur stehen sprechende neben singenden Darstellern, vermählt sich oft der Dialog mit dem Lied. Tragende Gestalt der harten, aus dem andalusischen Bauernleben gewonnenen Handlung ist die alte Mutter, eine dramatische Sopranpartie, die gleich in der ersten Szene im Dialog mit ihrem Sohn (einer Sprcchrolle) gezeigt wird. Er wird die ehemalige Verlobte eines Mannes heiraten, der zur Familie seiner Todfeinde gehört. Die Alte ahnt das Unheil. Bei der Hochzeit entführt der längst verheiratete Feind die Braut. Im nächtlichen Wald holt der verlassene Bräutigam die Fliehenden ein, und die Todesschreie der kämpfenden Männer mischen sich in die Stimmen der Natur. Das Mädchen, die andere große Frauenpartie, stellt sich im Schlußbild dem Rachedurst der Schwiegermutter. Doch seine stolze Keuschheit lähmt den Arm der Alten, und in trostloser Trauer vereinigen sich die Frauen, während Nachbarinnen sich um das Kruzifix scharen, das die Hand der Mutter hält.
Fortner hat die Handlung in sieben Bilder und zwei Akte geteilt. Es ist ein lyrische Tragödie, zu der die Musik als integraler Bestandteil tritt. Alles an dem Werk ist ungewöhnlich. Vieles in Lorcas Text sträubt sich gegen Musik, will einfach gesprochen werden. Was die Handlung weitertreibt, fordert Dialog. Aber unversehens gerinnt ein Gefühl, ein Affekt, eine innere Vision der Mutter, zur lyrischen Station. .
Die simple Technik des Singspiels ließ sich hier nicht anwenden. So erweitert Fortner die schön- bergsche, auch in Bergs „Wozzeck“ angewandte Form des Fluktuierens zwischen Sprechen und Singen. Aus dem so erreichten ästhetischen Transitzustand treten geschlossene Formen hervor: ein Wiegenlied von einfacher Schönheit, ein altspanischer Cante Jondo mit zigeunerischen Melismen, ein Lied der alten Magd, ein Frauenterzett. Die gesprochenen Szenen im Hochzeitsbild, zu denen im Hintergrund nach einer weich-herben Musik mit Gitarren und Kastagnetten getanzt wird, liefern Beispiele einer zweischichtigen musikdramatischen Situation von ungewöhnlichem Reiz.
Und dann die große Szene: der Wald, sie ist Höhepunkt des Stücks, ein Actus Tragicus ganz jenseits aller Opernkonvention, nur auf einen Zwölftonkanon zweier Geigen, eine Tenorarie des Mondes, die Chansonerzählungen der alten Bettlerin gestellt, hinter der sich der Tod verbirgt.
Für die besondere Struktur dieser Musik zeigte Günter W a n d bei der Kölner Uraufführung eine auffallend sichere Hand. Die. Hingabe seiner Stabführung übertrug sich auf das Gürzenichorchester, die Solisten, den Chor. Erich Borman führte Regie, keinen falschen Ton in den Dialogen zulassend, die Ensembleszenen meisterhaft lenkend. Mit Anny Schlemm als Braut, Natalie Hinsch-Gröndähl als Mutter, Gerhard Nathge als Mond, hinterließ der Abend musikalisch wie dramatisch die tiefsten Wirkungen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!