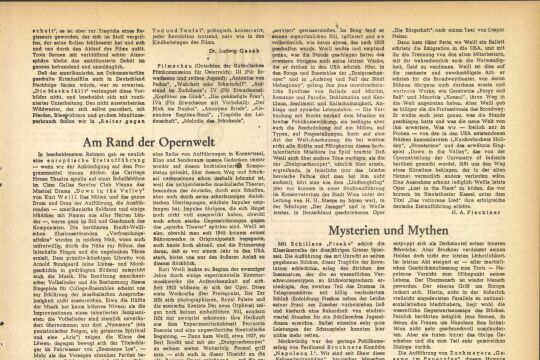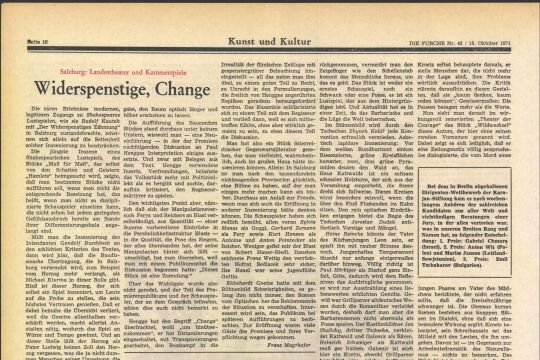Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
„Boris“ und „Galizien“
Höhepunkt des dramatischen Anteils am diesjährigen Steirischen Herbst war zweifellos die österreichische Erstaufführung von Thomas Bernhards Theatererstling „Ein Fest für Boris“. Thema und Substanz dieses Stückes sind wie stets bei Bernhard, so auch hier: Verfall, Zerstörung, Tod. Bernhard, der Epiker, wagt sich auf die Bühne und legt vor diesem Schritt freiwillig und kühn die Waffen ab, die ihm dabei dienlich sein könnten: sämtliche Figuren bis auf eine sind beinlos, an Rollstühle gefesselt — Krüppel, Rumpfexistenzen. Das heißt von vornherein: Verzicht auf Aktion, Bewegung, dramatische Mobilität. Für einen Dramatiker fast masochistisch wirken die beiden Vorspiele, langausgedehnte „handlungsschwache“ Szenen, mit ihrem Verzicht auf den Dialog zugunsten eines ungeheuren, replikenlosen Monologs der Protagonistin — einem eigenartigen, nur vordergründig monotonen Text, der in banalen Wendungen, halben Sätzen, Wiederaufnahmen von Gesagtem in seltsamen Kreisbewegungen den Hörer (aber auch den Leser) in seinen Bann zieht. Man ist versucht, von Raffiniertheit zu sprechen, sieht man die Kontrastwirkung jener Stellen, die wie eine Explosion von Bewegung, Farbe und Lauten sich von dem Grau-in-Grau des Monologs abheben.
Der dritte Teil, das „Fest“, das dem Krüppel Boris gegeben wird und an die zwei Dutzend Beinloser um die Tafel versammelt, ist im Grunde wieder Kreisen und Wiederholen, aber in schattierenden Variationen und klanglichen Abstufungen, bis es — unterstützt durch absurde Trommelschläge — einem grellen Schlußpunkt zustrebt, dem Totenstille, dann aber sogleich finales Gelächter folgt: Einbruch des Todes in eine todgeweihte Welt. Für einen Regisseur muß es eine faszinierende Aufgabe sein, diesen Text in Szene zu setzen, zumal für einen Künstler wie Axel Corti. So gelang diesem auch eine sehr beachtliche Wiedergabe des schwierigen Werkes, ohne daß allerdings dem Publikum jegliche Ermüdung erspart geblieben wäre. Christian Schieckels Raumge staltung ist ein glänzender Wurf, nicht genug gelobt werden kann Heidemarie Theobald in der Rolle der „Guten“ — eine faszinierende Leistung.
Unverzeihlich ist indessen der Mißgriff der Programmgestalter, mit dem sie ein Werk des bekannten kroatischen Autors Miroslav Krleža aufs Programm setzten. Dieses Stück nennt sich „Galizien“ und stellt die 1971 verfertigte Neufassung eines anderen Dramas dar. Man könnte es als Machwerk bezeichnen, wären da nicht ein paar dichte Szenen und einige poetische Stellen. Der Kommunist Krleža, der selbst in der österreichisch-ungarischen Monarchie gedient hatte, will offensichtlich mit dieser Fünfkreu- zergeschichte zeigen, wie unsinnig und grausam jeder Krieg ist. Er tut dies, indem er geflissentlich allen Unrat der schwarzgelben Armee konzentriert zutagefördert, so als ob dieses Heer nur aus Sadisten, Debilen und Homosexuellen bestanden hätte. Aus diesem Schlamm ragt nur ein träumerischer, romantischer Jüngling hervor, der schließlich Chopin-spielend in einer knalligen Bühnenschießerei zugrunde geht. Einem halbwegs gelungenen ersten Akt folgt ein öder zweiter mit nächtlicher Philosophiererei, leitartikeln- den Monologen und serienweisen Statements der uniformierten Figuren. Der dritte Akt führt in eine Art Operettenkasino, in dem es auch entsprechend banal und billig zugeht. Das Programmheft schwelgt in Krleža-Zitaten, die die Monarchie besudeln, und das gutwillige Publikum soll womöglich noch die Schmähung der eigenen Vergangenheit goutieren, weil „man heute eben so aufgeschlossen“ ist…
Unfaßbar, daß ein Regisseur wie Fritz Zecha dieser Billigkeit etwas abgewinnen konnte. Die Aufführung trägt die Qualitätsmarke Zechascher Inszenierungskunst, wobei einige schauspielerische Leistungen (vor allem die von Heribert Sasse und Elmar Schulte) sowie das sehr suggestive Bühnenbild von Thomas Rich- ter-Forgach auffallen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!