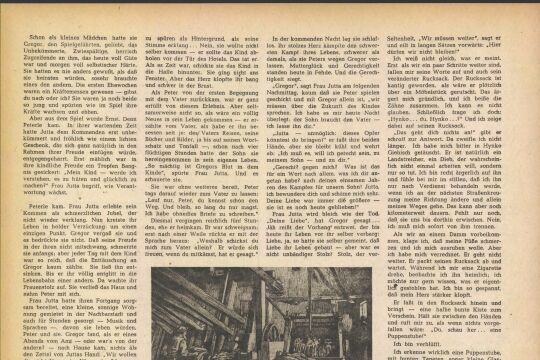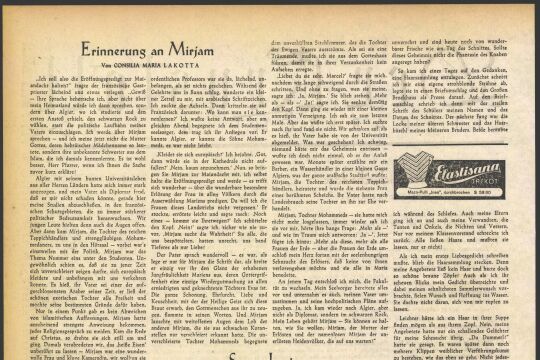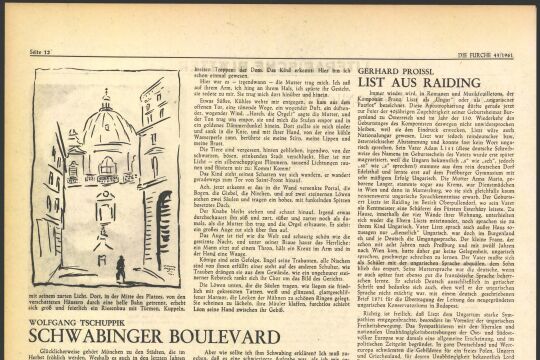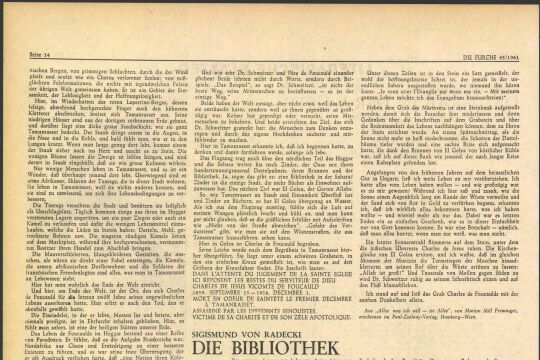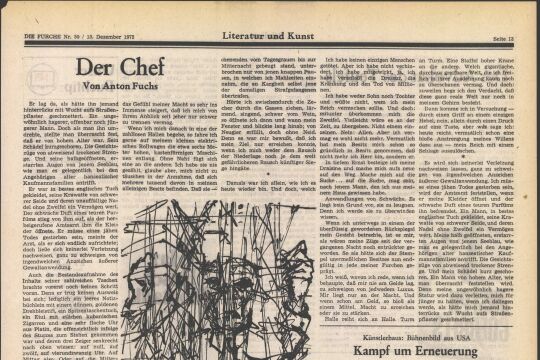Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Der Narr auf dem Hügel
Helmut Eisendle hat ein neues Buch geschrieben: Meditationen über Landstriche. Flüsse. Städte und Dinge. Die FURCHE freut sich, eine Leseprobe des subtilen Werks durch A bdruck der ersten Passagen des letzten Teils „Dinge" zugänglich zu machen. Das Buch erscheint in diesem Herbst im Residenz- Verlag, Salzburg.
Helmut Eisendle hat ein neues Buch geschrieben: Meditationen über Landstriche. Flüsse. Städte und Dinge. Die FURCHE freut sich, eine Leseprobe des subtilen Werks durch A bdruck der ersten Passagen des letzten Teils „Dinge" zugänglich zu machen. Das Buch erscheint in diesem Herbst im Residenz- Verlag, Salzburg.
Die Philosophie ist der Grundstein des Vergnügens. ♦
Nicht nur Götter und Geister oder die Natur als solche sind mythologisch; auch die Dinge selbst, die einzelnen Dinge unserer Erfahrung sind nichts anderes als Symbole, Begriffe, Vokabeln der Sprache, mit der wir die Ursachen ihrer Eigenschaften zusammenfassen.
Wir sehen die Welt der Erfahrung, die sogenannte Wirklichkeitswelt, als diejenige, die sich in Eigenschaften, in Adjektiven, äußert. Eine andere wäre starr und leblos.
Neben dieser Eigenschaftswelt hat die Sprache eine substantivische erzeugt, eben die Welt der Hauptwörter, der Götter, der Geister, die Welt der Kräfte und die Welt der Dinge; eine mythologische Welt, eine Dingwelt.
Das Ding-an-sich ist als Optimum der sogenannten Dingwelt formlos und hat keine Eigenschaft; es ist nicht einmal die Energie, wie Kant und seine Söhne dachten; es ist rundweg nur das Ding-an-sich; nichts. Dingsda eben, ein unbekannter Gegenstand.
Obwohl dieses Dingsda, das Ding- an-sich, nichts ist, kann man mit ihm wie mit allen Dingen spielen, es eben zu Gedanken, nein, Gedankendingen machen, die trotzdem keine Scheinbegriffe, werden, denn es gibt sieja, oder?
Vielleicht sind, wie Mauthner behauptet, doch alle Dinge an die Sprache gebunden, also nur Gedankendinge. Ohne Gedanken, meint er wohl, gibt es keine Dinge, zumindest nicht für uns. An die Phantasie des Denkens gewöhnt man sich leicht bei einfachen Begriffen wie:
Regen,
Wind,
Blitz und Donner,
Wetter und Götter.
Einen Donner gibt es nur einmal, wie das Echo. Er ist kein zweites Mal da.
gleich wie die Birne, die vor uns liegt, kein zweites Mal da ist. Sie ist ein anderes Mal da, doch in unseren gehörten, gedachten Wahrnehmungen und Empfindungen gibt es Donner und Birne nur einmal. Auch der Blitz, der Regen, das Wetter ist nur einmal vorhanden, außer wir erzeugen gegen das, was wir spüren und sehen und wahrnehmen, etwas ähnliches in Projektionen, in Hypostasen, in Träumen, in Worten, in Erfindungen, in Gedanken.
Die Trennung der Eigenschaftswelt von der Dingwelt ist ein philosophischer Spaß, eine Bosheit der Denker.
Wir lächeln über den Buben, mit dem wir eine Reise in den Süden gemacht haben, während der er das Meer, den Sand, die Sonne, die Berge gesehen hat, wir lächeln, wenn er uns fragt:
Ja - aber wo ist denn nun die Reise?
Lächelnd behaupte ich, wir sind wie das Kind, wenn wir die Szientisten kritisch nach Blitz und Donner fragen: Ja, sicher, das Geräusch, die Schwingung der Luft, gut, Elektrizität, gut, aber wo sind der Blitz und der Donner, Herr Professor?
Wo ist denn der Apfel, der Apfel-an- sich, der Apfel selbst, der Apfel außerhalb seiner Form und Eigenschaften, Herr Universitätsprofessor?
Anorganische Chemie, organische Chemie, wo ist der Apfel ohne Sauer, Süß, Saftig, Rund, Reif außerhalb unserer Sprache, Herr Dozent?
Wir wollen den Apfel mehrmals haben, obwohl die Natur ihn uns nur einmal gegeben hat.
Eben Sprache und Gedanken. Sprechen und Denken und Träumen sind die einzige Möglichkeit, etwas zweimal, dreimal, oftmals zu haben. Gedankendinge.
Die konkreten Substantive, die Hauptwörter, die Dinge-an-sich also, sind Scheinbegriffe wie die äbstrakten Begriffsungeheuer der Mythologen.
Das Ding-an-sich, das Apfel-Ding, das Pferde-Ding, das Auto-Ding, das Lebens-Ding, das Dingsda, das Dingsda-Ding, das Ding-an-sich- Dingsda-Ding, Das Apfeldingsdading- ansichdading, das Pferd, Dingsda, das Pferde-Dingsda-Ding. Wie heißt das Dingsda? … (Fritz Mauthner, Wörterbuch der Philosophie, Bd. I, II)
Ich sitze in meinem Zimmer und denke, wie immer.
Wenn ich aus dem Fenster blicke, sehe ich die Unheimliche Front. Ein Ding.
Ein Leichenwagen fährt stadteinwärts, leer oder belegt, keiner, der ihn sieht, weiß es, außer der Chauffeur. Auf seinem Dach liegt beiläufig ein Kranz. Das Automobil bleibt stehen, rollt wie die anderen in der Kolonne schräg durch mein Fenster.
Die Jalousien sind halb heruntergelassen und nehmen mir den Blick auf den oberen Teil der Unheimlichen Front. Erst wenn ich mich weit vor- beuge, sehe ich, daß dort oben nichts Besonders passiert. Die Fenster sind schmutzig; alles liegt in einem künstlichen Nebel, ein Grauschleier bedeckt die Straße, obwohl klares Wetter herrscht.
Rechts spiegelt sich die Scheibe, und ich sehe die Schreibtischlampe, links davon bin ich selbst. Ich beginne zu lachen. Ich sehe mich, wenn ich aus dem Fenster blicke.
Die linke untere Scheibe hat einen Sprung. Ich weiß nichts über seine Geschichte. Ich erinnere mich an Berlin, einen Abend, wo ich im Zorn ein schwe-
res Weinglas durch ein Doppelfenster schleuderte.
Über dem Sprung, der an einer Stelle in drei Richtungen läuft, klebt ein Photo. Es zeigt die Freundin, eine andere und mich, während einer Ausstellung.
Sich selbst ständig vor sich auf einer Photographie zu sehen, verändert die Selbsteinschätzung des Älterwerdens, der Falten, des Äußeren. Man meint, daß man immer so bliebe wie auf dem Photo. Nicht einmal im Inneren bleibt man unverändert. Eines Tages sagt man, daß man der auf dem Bild früher einmal gewesen sei. Aber heute?
Auf dem Fensterbrett liegen mehrere Messer, Taschenmesser; staubig und unbenutzt; ein steirischer Feitl in unnatürlichem Violett, ein Messer aus Venedig in Form einer Gondel, eines aus Barcelona, es stellt ein Frauenbein dar mit einem Schuh aus Messing, das schneidende Schienbein, das Schien- und Schneidebein, ein bayerisches Brotzeitmesser, lang, mit einer kleinen Gabel zum Aufstechen des Fleisches, ungefährlich, ein Springmesser ganz aus Metall aus Napoli, es ist keine Waffe, aber ein Symbol einer solchen, ein Chiemgauer Taschenmesser, in seiner gründlichen Art das Feinste der Sammlung.
Eine Kollektion.
Messer werden in unserem symbolkapitalistischen Lebensraum dann als Waffen behandelt, wenn die Länge ihrer Klingen die Handbreite übersteigt.
Warum große Menschen längere Messer haben dürfen, erklärt die Vorschrift nicht. Das Feststehende und die Länge der Klinge sind das Kriterium des illegalen Waffenbesitzes.
Zwanzig Meter weiter, in der Küche, liegen drei oder vier große Messer mit feststehender Klinge. Ihre Länge entspricht meiner doppelten Handbreite. Doch Hausfrauen sind keine Mörder. Ich allerdings, als Mann, stehe unter Verdacht. Vielleicht betrete ich deshalb die Küche eher freudlos?
Ein Messer ist nicht mehr als ein Symbol der Gewalt, ein Mythos, doch der, der es benutzt, ist stets der Gewaltausübende. Er macht das Symbol zu einem Ding, gibt ihm eine Eigenschaft, eine Form, eine Bedeutung. Das Ding, das Messer, ist nicht mehr das Ding-an- sich, das Messer-an-sich, sondern das Ding-außer-sich, das Messer-außer- sich. Verhält man sich nicht mehr geordnet, ist man außer sich wie ein Messer, das seinen Benützer gefunden hat.
Die Verordnung über die Klingenlänge als Kriterium des Besitzrechtes ist nicht richtig, doch erschwert sie den möglichen Gebrauch.
Sie ist recht.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!