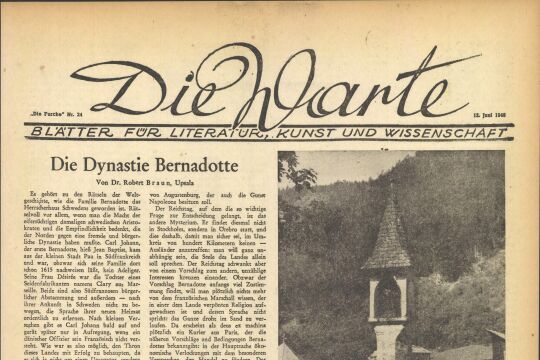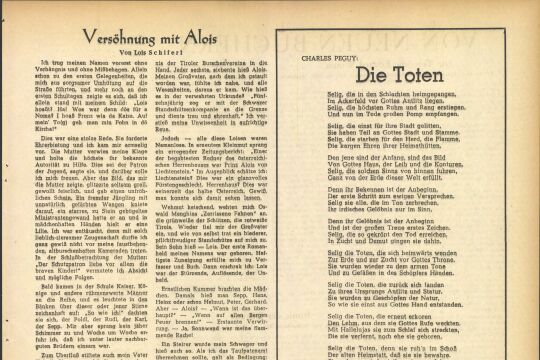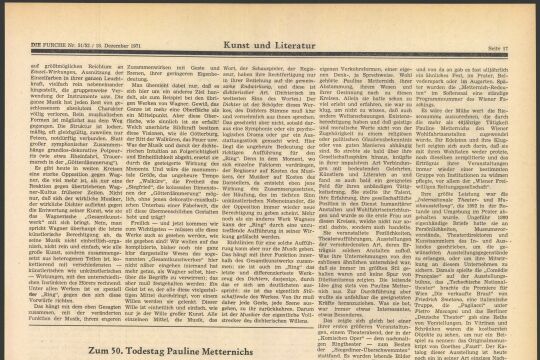Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Im Trauungsbuch fehlt ein Blatt....
Schon jetzt feiert Wien seinen Johann Strauß, obwohl er doch erst am 25. Oktober vor 150 Jahren auf die Welt kam. Wien feiert ihn schon jetzt schwelgerisch — exzessiv wird es wohl erst im Herbst. Ein guter Anlaß, der Herkunft dieses Mannes zu gedenken. Dieses Mannes, den Richard Wagner den „musikalischesten Schädel in Europa“ genannt hat und dem Wien ein gutes Stück seines Renommmees als Musikstadt verdankt.
Bei dieser Gelegenheit sollten wir uns aber auch eines Vorfalles erinnern, der sich in den frühen dreißiger Jahren abgespielt hat. Und dessen, was nach dem Einmarsch der deutschen Truppen darauf folgte. Denn fast wäre uns Johann Strauß damals für sieben Jahre abhanden gekommen.
Ausgerechnet in den dreißiger Jahren stoßen zwei Wiener Familienforscher, Hanns Jäger-Sustenau und Hans Bourcy, in der Pfarrmar trikel von Sankt Stephan auf unwiderlegbare Beweise dafür, daß Johann Strauß nicht das war, was man damals einen reinen Arier nannte. Ein Umstand, der, träte er heute erstmals zutage, kaum besonders zur Kenntnis genommen würde.
Denn dieses Wien, das schon lang vor seinem Bürgermeister Lueger stets selbst bestimmt hat, wer ein Jud' war und wer nicht, war ja stets noch bereit, bei allen jenen, die ihm Ehren einbrachten, nicht lange nach der Herkunft zu fragen. Aber die neuen Herren des Jahres 1938 waren da ganz anders und rigoroser. Auch und manchmal vor allem dann, wenn zwischen dem einen oder anderen in solchen Sachen eher gleichgültigen oder gar toleranten Wiener und dem nachmaligen Bewahrer deutschen Wesens eine Personalunion bestand.
Es erzählt also eines Tages, nach dem Anschluß Österreichs an das „Reich“, Bourcy einem Bekannten von seinen Forschungen in den Matrikelbüchern von Sankt Stephan.
Er erzählt dem Bekannten, was er dabei entdeckt hat. Nämlich, daß Johann Strauß zwar nicht gerade ein Jude war, aber halt doch zum Teil, und das war damals bekanntlich schon schlimm genug. Der Bekannte war zufällig Beamter einer Behörde, die auf den stolzen deutschen Namen „Gausippenamt“ hörte. Natürlich konnte und durfte der plötzlich deutsche Mann nicht schweigen.
Strauß stillschweigend zu „vergessen“ und weniger bis gar nicht mehr zu spielen, das ging nicht. Denn was besonders peinlich war — der „Stürmer“, jenes polit-porno-graphische Hetzblatt, wußte just damals zu melden, daß „die jüdischen Erbschleicher den Nachlaß Johann
Strauß' an sich zu reißen ' versuchten“. Und diese Eröffnung beschränkte sich keineswegs auf einen Artikel. Nein, sie war auf einem Plakat zu lesen, das für den „Stüimer“ warb, und gelangte auf diese Weise auch Kreisen zur Kenntnis, die nicht gerade den „Stürmer“ zu lesen pflegten.
Auf diesem Plakat stand auch noch: „Es gibt wohl kaum noch eine Musik, die so deutsch und so volksnah ist, wie die des großen Walzerkönigs.“ Wer einmal so apodiktisch für das Ariertum reklamiert war, konnte unmöglich mehr zum Juden, nicht einmal zu einem Viertel-, Achtel- oder Sechzehnteljuden, degradiert werden. Undenkbar.
Und so wurde Strauß arisiert. Arisiert wie so manches jüdische Geschäft, so manche jüdische Wohnung, so manche jüdische Fabrik. Eines Tages wurden die beiden Familienforscher in das Gausippenamt gebeten und dort höflich, aber bestimmt aufgefordert, zu vergessen, was sie über Johann Strauß eruiert hatten. Im Dompfarramt zu Sankt Stephan aber erschienen auffallend unauffällige Herren, die das Trauungsbuch, das die Nummer 60 trug, und die Heiraten der Jahre 1761 und 1762 enthielt, beschlagnahmten.
Als es zurückkam, fehlte eine Seite. Die an ihrer Stelle eingefügte Photokopie enthielt keinen Hinweis auf die jüdische Abkunft des Straußschen Urgroßvaters mehr. Dafür aber einen Stempel: „Die Ubereinstimmung dieser Photokopie mit dem vorgelegten Original wird hiermit beglaubigt. Berlin, den 20. Februar 1941. Reichssippenamt.“
In Wien sprach es sich bald herum, daß aus dem Dompfarramt ein Trauungsbuch verschwunden war, aber die Wiener zogen daraus völlig falsche Schlüsse. Niemand dachte an Johann Strauß. Man flüsterte einander vielmehr hinter vorgehaltener Hand zu, der NS-Gauleiter Baidur von Schirach habe jüdische Vorfahren „arisiert“.
Der Großvater von Johann Strauß hieß Johann Michael Strauß. Er wurde 1720 in Ofen geboren und brachte sich als „Bedienter und Tapezierer“ durch. Wahrscheinlich hat er sich taufen lassen, um die Katholikin „Rosalia Buschinin aus Gföll in Niederösterreich“ heiraten zu können. Sein Sohn Franz arbeitete sich eine mächtige Stufe höher hinauf. Er begann als Kellner und starb als Schankwirt in der Wiener Leopoldstadt.
Erst die nächste Generation entdeckte die Musik, und wurde von der Musik entdeckt. Johann Strauß Vater wurde ein berühmter Musiker, aber noch wohnte die Familie — mit
fünf Kindern — in' einer winzigen Wohnung im sogenannten Hirschenhaus. Von jüdischer Erziehung war keine Rede. Die Farnilie Strauß war auf dem Wege, eine Wiener Bürgerfamilie zu werden.
Johann Strauß Vater hatte allerdings vom bürgerlichen Dasein eines Tages genug und wurde unbürgerlich. Er legte sich eine Freundin zu, eine Modistin namens Emilie Tramputsch, die ihm noch einmal, fünf Kinder schenkte, so daß er schließlich zwei Frauen und zehn Kinder zu ernähren hatte und ihm überhaupt nichts anderes übrig blieb, als ein erfolgreicher Musiker zu sein. Um der Wahrheit die traurige Ehre zu geben, muß gestanden werden, daß die illegitimen Sträuße, die von den legitimen Sträußen als Kuckucke betrachtet würden, sehr viel luxuriöser lebten.
Vielleicht hatte Johann Strauß Vater ein schlechtes Gewissen, und vielleicht machte er seinen Beruf und die damit verbundenen Versuchungen dafür verantwortlich, daß er lebte, wie er lebte — Faktum ist, daß er die Erziehung seiner ehelichen Kinder sorgfältig überwachte und sie auf bürgerliche Berufe festzulegen suchte. Johann wurde in das Schottengymnasium und anschließend auf die Handelsschule geschickt, Josef sollte auf die Universität gehen. Den Klavierunterricht konnte er seinen drei ehelichen Söhnen nicht gut verbieten. Das war weniger deshalb unmöglich, weil sie siin Talent geerbt hatten, was der Fall war, als vielmehr deshalb, weil zu der bürgerlichen Zukunft, die er für sie ins Auge gefaßt hatte, nun einmal auch eine gewisse Musikkultur gehörte.
Als er aber eines Tages seinen ältesten Sohn Johann mit einer
Violine erwischte, und nicht nur mit einer Violine, sondern obendrein vor dem Spiegel, und nicht nur vor dem Spiegel, sondern dort obendrein in der Art des Vaters Grimassen schneidend, und mehr als das, und was das schlimmste war, auch tatsächlich geigend, nota bene eigene Komposition — da gab es einen Skandal.
Und es gab einen noch größeren Skandal, als Vater Strauß erfuhr, wer dem Sohn Stunden gab. Nämlich Vater Straußens eigener Primgeiger. Und keineswegs gratis. Der hoffnungsvolle Sohn hatte sich das Geld für den Geigenunterricht selbst verdient, indem er dem benachbarten Schneider Klavierstunden gab.
Die Geige wurde eingesperrt. Anna Strauß kaufte ihrem Sohn am nächsten Tag eine neue.
Johann Strauß war damals 15 Jahre alt. Bald darauf trug er zum Lebensunterhalt seiner Familie, die von dem Geld, das der Vater monatlich schickte, nicht leben konnte, selber bei. Was heute kaum jemand weiß: Johann Strauß hat seine Karriere als Berufsmusiker keineswegs als Geiger, sondern als Komponist, und zwar als Kirchenkomponist begonnen. Der geistliche Kapellmeister Josef Drexler war seih Lehrmeister. Sein erstes Gra-duale für Chor und Orchester, das „Tu quis regis totum orbem“, wurde in der Kirche Am Hof uraufgeführt. Johann Strauß wäre heute sicher als großer Kirchenkomponist bekannt, wäre in seinen Adern nicht das Blut eines echten Volksmusikers geflossen. Drexler war betroffen, als er seinen Schüler verlor, aber er reagierte menschlich und humorvoll: „Na, so gengan S' halt und schreiben S' Walzer wie Ihner Vater. Dazu hätten S' aber den Kontrapunkt net braucht.“
Vielleicht hat er ihn doch gebraucht — vielleicht ist Johann Strauß der Jüngere nicht zuletzt auch dank seiner fundierten musiktheoretischen Ausbildung über seinen Vater hinausgewachsen. Er war 19 Jahre alt, als er seine Komponistenlaufbahn beendete, um ein Walzerorchester zu • gründen. Er holte sich vom Magistrat die erforderliche Lizenz, aus der Herberge „Zur Stadt Belgrad“ 15 arbeitslose Musiker, und bereitete seinen ersten Auftritt in Dommayers Gartenrestaurant in Hietzing vor.
Die näheren Umstände, der winzig gedruckte Zusatz „Sohn“ zum Namen Johann Strauß auf den Plakaten, der Konflikt zwischen Vater und Sohn, sind, wenn wir uns richtig erinnern, nicht zuletzt aus in der Nazizeit gedrehten Filmen bekannt.
Sein Urgroßvater war also Jude. Einer jener ungezählten Juden, denen Josef Roth ein Denkmal setzte. Sie kamen nach Wien und siedelten sich im 2. Bezirk an, fristeten eine Existenz auf der untersten sozialen Stufe. Erst ihre Söhne und Enkel brachten es zu etwas. Sie aber, die jüdischen Einwanderer der ersten Generation, brachten Wien ein gewaltiges Potential an Begabung, an Leistungswillen, aber auch an sozialer Unruhe, von dem sich von Generation zu Generation etwas fortpflanzte. Etwas davon war auch in Johann Strauß Sohn noch lebendig, der zwar vor Kaisern und Königen musizierte, von dem man aber sehr gut wußte, auf welcher Seite er im Revolutionsjahr 1848 gestanden hatte.
Johann Strauß Sohn hätte nach den Nürnberger Gesetzen als Achteljude gegolten. Hätte dieses Achtel nicht ausgerechnet von jenem Strauß gestammt, der den Namen weitergab, hätte sich auch das Reichssippenamt nicht darum geschert, und wahrscheinlich wären auch die beiden Wiener Familienforscher nie auf den jüdischen Urgroßvater gestoßen.
Denn das Potential an künstlerischer und intellektueller Begabung, an Fleiß und Aufstiegswillen, das viele Generationen jüdischer Einwanderer nach Wien gebracht haben, lebt und wirkt auch in einem Wien weiter, in dem so mancher nicht gerne an „so etwas“ erinnert wird. In dem so mancher nicht gerne und schon gar nicht gerne mit Dankbarkeit an einen möglichen jüdischen Urgroßvater denkt.
Was fast unbegreiflich ist in einer Stadt, die wie kaum eine andere ihren Reichtum an schöpferischen Kräften den Urgroßvätern aus allen Richtungen der Windrose verdankt, den ungarischen und böhmischen, den jüdischen und tschechischen, den deutschen und jugoslawischen, den italienischen, serbischen, kroatischen, slowenischen, und all den anderen Urgroßvätern, auf die jeder von uns stolz sein darf.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!