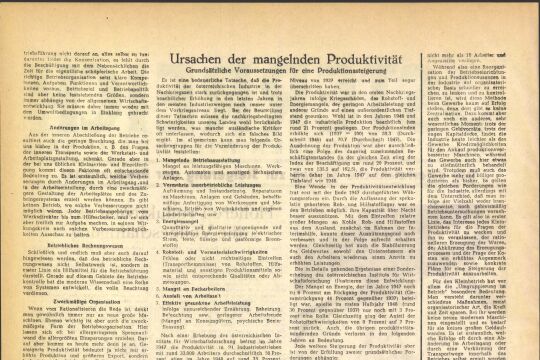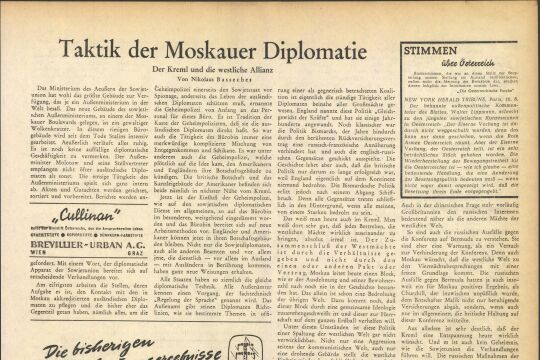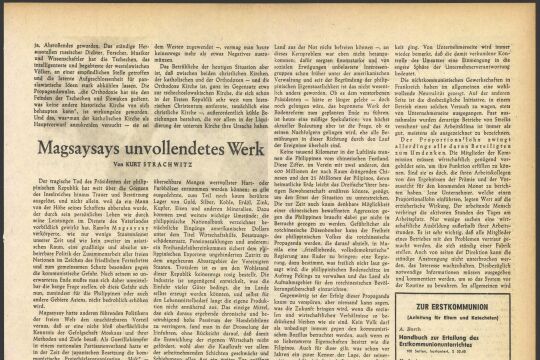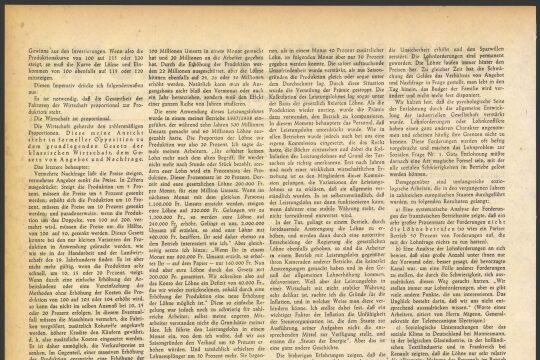Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Mehr Mensch durch Arbeit
Im Rahmen des Kummer- Instituts sammelte eine Arbeitsgruppe Beispiele, wie Änderungen im Betrieb zu mehr Zufriedenheit bei Mitarbeitern führt.
Im Rahmen des Kummer- Instituts sammelte eine Arbeitsgruppe Beispiele, wie Änderungen im Betrieb zu mehr Zufriedenheit bei Mitarbeitern führt.
Daß es hoffnungsvolle Ansätze auch im Bereich der Wirtschaft gibt, Arbeit also Freude und nicht nur Leid bereitet, wollten der Verband christlicher Unternehmer und die Junge Wirtschaft im Rahmen einer Arbeitsgruppe heraussteilen. Dabei sollten nicht theoretische Überlegungen, sondern praktische Erfahrungen im Vordergrund stehen.
Will man die Arbeitswelt humanisieren, so geht es vor allem darum, den Mitarbeiter in die Verantwortung mit einzubeziehen und die menschlichen Kontakte zu seiner Umgebung zu fördern, wie die folgenden Beispiele zeigen.
Josef Lins, Innungsmeister der Vorarlberger Dachdecker, leitet als Einzelunternehmer einen Betrieb mit 15 bis 20 handwerklich ausgebildeten Mitarbeitern. Ausgehend von der Tatsache, daß ein sehr deutliches Gefälle zwischen seinem eigenen Einkommen und dem seiner Mitarbeiter bestand, erwog er vor etwa 20 Jahren, diese an den Gewinnen des Unternehmens zu beteiligen.
Zwar lehnten sie zunächst seinen Vorschlag ab, nach einigen Jahren wurde jedoch ein Konzept entwickelt, das heute etwa folgendermaßen funktioniert:
Zwei Drittel des Betriebsergebnisses kommen zum Risikokapital im Betrieb. Das restliche Drittel wird an die Mitarbeiter ausgeschüttet, die frei darüber verfügen können. Allerdings besteht auch die Möglichkeit, das Geld als Darlehen (mit Bankhaftbrief gesichert) im Betrieb anzulegen.
Und nach welchen Kriterien wird dieses Gewinndrittel verteilt? 20 Prozent nach der Betriebszugehörigkeit, 30 Prozent nach den tatsächlich im Jahr geleisteten Arbeitsstunden, 23 Prozent entsprechend der Lohn- bzw. Gehaltssumme und der Rest nach individueller Beurteilung. Diese erfolgt zu zehn Prozent durch den Chef und zu 17 Prozent nach vorgegebenen Kriterien.
Trotz großer Skepsis der Gewerkschaft hat sich dieses Modell gut bewährt. Vor allem trug es zu deutlich mehr Engagement der Mitarbeiter bei. Gestiegen ist auch die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, wodurch sich viel Kontrolle, insbesondere von oben, erübrigt. Besonders zu verzeichnen ist aber, daß die Freude an der Tätigkeit im Unternehmen deutlich gestiegen ist.
In einem Teilbereich von Siemens Austria, der etwa 350 Arbeitnehmer umfaßt, wurden zwei Jahre hindurch Erfahrungen mit Kobtaktgruppen gesammelt. Unter der Anleitung von Wissenschaftern aus mehreren Disziplinen (Psychologen, Medizinern, Technikern) sollte einem Hauptproblem am Arbeitsplatz zu Leibe gerückt werden: der mangelnden Kommunikationsfähigkeit der Arbeitnehmer.
Jeweils 15 freiwillige Teilnehmer fanden sich regelmäßig auf etwa eine Stunde während der Arbeitszeit zu Gruppensitzungen zusammen, um über gemeinsame Probleme zu beraten. Diese sachlich zu behandeln, erwies sich aber als besonders schwierig. Es überwogen die gefühlsmäßigen Äußerungen.
Im Verlauf von ungefähr sechs Monaten gelang es im großen und ganzen, daß sich die Gruppen sachliche Konfliktlösungsstrategien erarbeiteten. Konkrete Probleme, wie etwa die Einrichtung eines abgetrennten Eßplatzes für die Lackierer oder die Neugestaltung von Schaltplänen, konnten dann von den Beteiligten selbst gelöst werden.
Mit solchen Lösungen kann sich der einzelne natürlich viel eher identifizieren als mit Verordnungen von oben. Und verständlicherweise führt eine solche Einbeziehung des Mitarbeiters auch zu seiner höheren Arbeitszufriedenheit.
Nach Abschluß des Versuchs, der 18 Monate gedauert und rund die Hälfte der Mitarbeiter erfaßt hatte, gab es einhellig ein positives Echo und den Wunsch nach Beibehaltung dieses demokratischen Mitbestimmungsmodells. Die Arbeit war menschlicher geworden.
Neue Wege im ländlichen Raum zu gehen, versuchte wiederum Melchior Kellner aus Bischofsho fen. Er sollte den elterlichen Bauernhof, auf dem Viehzucht betrieben wurde, übernehmen. Allerdings wäre dies nicht ohne Nebenerwerb tragbar gewesen. Schlechte Erfahrungen damit und der Wunsch, „so zu leben, wie die anderen“, führten ihn zu einer anderen Lösung: Er stellte auf Schafzucht um und füllte damit eine Marktlücke.
Weil aber nicht Milch-, sondern Woll- und Fleischschafe gezüchtet wurden, entfiel auch der Zwang zu täglicher Betreuung. Denn die Weidewirtschaft in den Sommermonaten erfordert wenig Aufsicht. Die gewonnene Freizeit wurde zum Aufbau von Beziehungen zu den Nachbarn genutzt: Eine Genossenschaft wurde aufgebaut, man leistet sich gegenseitig Nachbarschaftshilfe, etwa bei der Holzarbeit, und bildet sich in Arbeits- und Diskussionsgruppen weiter. Ein Anwendungsbereich des Wissens zeichnet sich bereits ab: Kleintechnologien mit dem Grundmaterial Holz zu entwickeln, wird als zukunftsträchtig angesehen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!