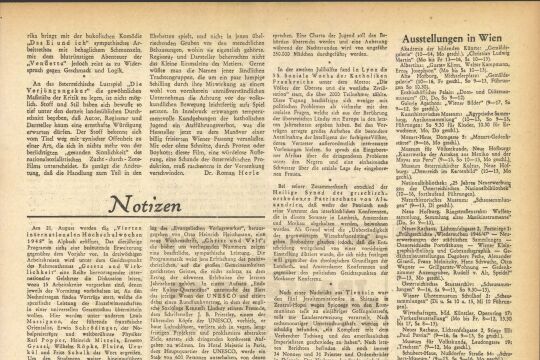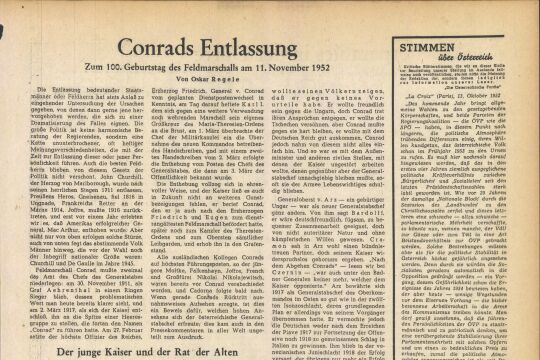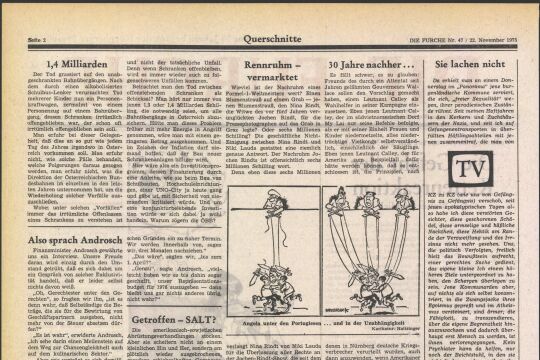Opernball 13
Als der Erste Weltkrieg begann, war bereits mehr verloren als nur eine Schlacht. Denn die Russen kannten alle Details der österreichischen Aufmarschpläne. Der Mann, der sie ihnen verraten hatte, hieß Alfred Redl. Vor 60 Jahren legte Oberst Urbanski von Ostromiesz dem Mann, der noch die Rangabzeichen eines Obersten trug, aber nur noch als „Herr Redl“ angesprochen wurde, seinen Revolver auf den Tiscli. Wenige Stunden zuvor war Redl als Spion entlarvt worden — Redl, Generalstabschef des 8. Armeekorps in Prag und zugleich einer der führenden Männer der österreichischen Spionageabwehr, ein Mann, in dem viele bereits Österreichs künftigen Armeekommahdanten, ja Kriegsminister sahen.
Als der Erste Weltkrieg begann, war bereits mehr verloren als nur eine Schlacht. Denn die Russen kannten alle Details der österreichischen Aufmarschpläne. Der Mann, der sie ihnen verraten hatte, hieß Alfred Redl. Vor 60 Jahren legte Oberst Urbanski von Ostromiesz dem Mann, der noch die Rangabzeichen eines Obersten trug, aber nur noch als „Herr Redl“ angesprochen wurde, seinen Revolver auf den Tiscli. Wenige Stunden zuvor war Redl als Spion entlarvt worden — Redl, Generalstabschef des 8. Armeekorps in Prag und zugleich einer der führenden Männer der österreichischen Spionageabwehr, ein Mann, in dem viele bereits Österreichs künftigen Armeekommahdanten, ja Kriegsminister sahen.
Wie tief die Entlarvung des angesehenen, zukunftsreichen Offiziers Redl als Kreatur des Feindes den greisen Monarchen getroffen hat, läßt sich unter anderem bei Fred Hennings nachlesen („Solange er lebt“, Band 4, Verlag Herold), wo General Freiherr von Margutti als Augenzeuge zitiert wird: „Auf des Grafen Paar beschwichtigende Gegenvorstellung, daß es selbst unter den zwölf Aposteln einen Judas gegeben, hörte der Kaiser nicht; er war von seiner entsetzlichen Enttäuschung niedergeschmettert. Tags darauf sah ich mit Bestürzung sein verfallenes Aussehen; er hatte während der ganzen Nacht kein Auge geschlossen. Und als er bald darauf erfuhr, daß man vielleicht schon Jahre vorher gegen Redl Verdachtsmomente hätte aufgreifen können, diese jedoch aus Opportunitätsrücksichten oder aus Sorglosigkeit nicht weiter verfolgt worden waren, da steigerte sich des Monarchen Wut ins Maßlose.“
Wahrscheinlich hat der alte Kaiser selbst mit besonderer Deutlichkeit den Fall Redl als Symptom des Verfalls empfunden. In heutiger Sicht bedeutete der Verrat Redls jedoch vor allem eine militärische Katastrophe für die Monarchie, während die Art und Weise, in der die Armeeführung den Skandal zu vertuschen suchte, als- Anzeichen eines-bederttelieh'Weit ■fo¥tgÄ6Kri«enen -^fflR&efPtetäiim-zungsprozesses eher noch schwerer wog als die Spionentätigkeit eines homosexuellen, russischer Erpressung zum Opfer gefallenen Offiziers.
Der Browning, der dem Obersten Redl zum Zweck der Selbstjustiz auf den Tisch gelegt wurde (General Höfer: „Sie dürfen um eine Schußwaffe bitten, Herr Redl.“ Redl: „Ich bitte gehorsamst um einen Revolver.“), hatte keineswegs den Zweck, einem problematischen Ehrenkodex Genüge zu tun, sondern sollte es Redls Vorgesetzten vor allem ermöglichen, die Affäre, kaum daß sie aufgedeckt worden war, so schnell wie möglich ad acta zu legen, da sie anders nicht geheimgehalten werden konnte. Geheimhalten aber wollte man sie, und „man“ war hier nicht zuletzt Conrad von Hötzendorf, in erster Linie vor dem Kaiser und noch mehr vor Franz Ferdinand, dem Thronfolger.
Die Primärquellen, betreffend die Ereignisse am Abend und in der Nacht des 25. Mai 1913, fließen spärlich. Allzuweit ist man nicht über das hinausgekommen, was der große, aber der österreichischen Vergangenheit keineswegs vorurteilslos gegenüberstehende Journalist Egon Erwin Kisch erheben konnte. Zu den Persönlichkeiten, die Kisch informierten, zählte Feldmarschalleutnant Urbanski von Ostromiesz, der von Kisch nach dem Ersten Weltkrieg tagelang interviewt wurde, unter anderem auch über die Frage, wieso der Verrat Redls eigentlich in die Öffentlichkeit gelangt sei, und der Redl erklärte, der Kriegsminister selbst habe die Information der Presse zugespielt — Urbanski wußte nicht und wollte nicht glauben, daß es sich ganz anders verhalten hatte und daß sein Gesprächspartner Kisch es selbst gewesen war, der auf die Fährte des Falles Redl gestoßen war.
Daß der homosexuelle Oberst Redl durch brutale russische Erpressung zum Spion gemacht worden war, dann aber Geschmack an den hohen russischen Honoraren gefunden und einerseits so manchen österreichischen Spion an den russischen Galgen geliefert, anderseits aber den unbarmherzigen Verfolger russischer Spione in Österreich gemimt hat, ist heute allgemein bekannt. Oberst
Redl ist eitel, er fährt einen Daimler für 18.000 Kronen und er hat Adelsambitionen, sonst hätte er nicht das Monogramm am Wagenschlag so verschnörkelt malen lassen, daß man (in Verbindung mit der leicht zu mißdeutenden Bürgerkrone) ein „von“ vermuten kann, wo keines ist, aber Redl, der hochintelligente Karrierist, kennt auch die Gefahren seiner Doppelrolle. Er braucht Geld für seine jungen Freunde, anderseits scheut er seit vielen Wochen den Weg auf die Wiener Hauptpost, wo längst — unter der Chiffre „Opernball 13“ — zwei Briefe mit insgesamt 14.000 Kronen postlagernd bereitliegen.
Der junge, hübsche Ulanenoffizier Hromadka aus Stockerau wird Redl zum Verhängnis. Der Freund will sich von ihm trennen, um zu heiraten, ist vielleicht mit einem Auto zu halten — Redl braucht das Geld. Er scheint die Gefahr gefühlt zu haben, tatsächlich warteten seit Monaten zwei Kriminalpolizisten in einem Nebenzimmer des Schalterraumes auf den Beheber der Chiffrebriefe. Weil sowohl der zuständige Polizeirat (zuletzt Johann Schober, Österreichs späterer Bundeskanzler) als auch die wartenden Beamten in diesen Monaten ausgewechselt worden waren, reagierten die Polizisten Ebinger und
Steidl etwas zu langsam, als die Klingel in ihrem Zimmer schrillte. Als sie den Abholer der Briefe festnehmen wollten, sahen sie ihn nur noch die Tür eines Taxis hinter sich zuschlagen und abfahren.
Der Fall Redl ist voll der tragikomischen Elemente. Die beiden Kriminalbeamten können die Nummer des Taxis ablesen — während sie noch beratschlagen, was zu tun sei, kommt dasselbe Taxi — leer — wieder an ihnen vorbei. Sie erfahren, daß der Unbekannte ins Cafe Kaiserhof gefahren ist. Auf der kurzen Fahrt dorthin finden sie im Fond des Wagens ein Taschenmesserfutteral aus hellgrauem Tuch. Der gesuchte Mann hat zwar das Cafe Kaiserhof längst wieder verlassen und ein neues Taxi genommen, aber der „Wasserer“ am Standplatz, der Mann, der den Taxifahrern die Würstel bringt und die Karosserien putzt, seit es keine Fiakerpferde mehr zu tränken gibt, weiß, welches Ziel er dem Fahrer genannt hat. Sie fahren ihm nach — ins Hotel Klomser, Herrengasse, Ecke Bankgasse. In diesem Hotel wohnt Redl.
Der Geheimpolizist Ebinger soll bei der Vorstellung, der gesuchte Mann wohne vielleicht mit dem Spionenfänger Redl Wand an Wand, schallend gelacht haben. Während er von der Telephonzelle in der Hotelhalle aus Polizeirat Schober informiert, reicht Steidl die Messerhülle dem Portier: „Fragen Sie, wem von den zuletzt angekommenen Gästen das Futteral gehört!“
Wenige Augenblicke später kommt Redl, der kurz vorher das Hotel in Zivil betreten hat, in Uniform die Treppe herunter und legt seinen Schlüssel — Zimmer 1 — dem Portier hin. „Haben Herr Oberst das Futteral Ihres Taschenmessers verloren?“
Wahrscheinlich hätte es nie eine Affäre Redl gegeben, dafür aber unausdenkbare militärische Katastrophen im bevorstehenden Krieg, wenn Redl in diesem Augenblick geistesgegenwärtig reagiert hätte. Er aber sagt ahnungslos: „Ja, ich suche es schon seit einer Viertelstunde. Wo haben Sie es denn gefun ...“ Im selben Augenblick sieht er einen ihm bekannten Kriminalbeamten das Gästebuch studieren. Egon Erwin Kisch: „Oberst Redl wird blaß wie ein Toter, denn er weiß, daß er ein Toter ist.“
Der Spionenjäger Redl war selbst ein miserabler Spion — wie sich herausstellte, hatte er die Chiffre „Opernball 13“ mit seiner normalen, unverstellten Schrift dem Postbeamten aufgeschrieben, sie wurde im Evidenzbüro an Hand seiner handschriftlichen Anweisungen über den Umgang mit Spionen identifiziert. In diesem Augenblick war Redl bereits auf der Flucht, zu Fuß, verfolgt von den beiden Detektiven, einen von ihnen konnte er abschütteln, der andere blieb ihm auf den Fersen. Redl ging, gefolgt von dem Polizisten Ebinger, zum Franz-Josephs-Kai und wieder zurück ins Hotel Klom-ser — er hatte die Aussichtslosigkeit seiner Lage erkannt.
In der Zwischenzeit stöbert Oberst Urbanski General von Hötzendorf auf („Was, mitten im Abendessen? Ist's wirklich so dringend? Na, alsdann, gehn wir.“). Konfrontiert mit der vollen Wahrheit, verliert dieser für einen Augenblick die Fassung:
„Heraus mit der Sprache, August. Ich bin ja darauf vorbereitet, daß es nicht der erste beste ist.“
„Exzellenz — es ist Oberst Redl.“
„Wer? Sind Sie wahnsinnig geworden? Nehmen Sie sich in acht, Herr Oberst!“ Hötzendorf schreit, faßt sich aber sofort wieder: „Entschuldige, August. Oberst Redl! Ist denn das sicher?“
August Urbanski berichtet, wie Conrad auf einen Stuhl sank und beide Hände auf das Herz preßte — und dann lange Zeit kein Wort sprach. Dann entschied er: „Dieser Schuft hat sofort zu sterben“, von eigener Hand, nach einem Verhör durch eine vierköpfige Kommission, über den Vollzug sei am nächsten Morgen direkt an ihn zu melden. Das Verhör dauert nicht lange. Redl gibt alles zu und erklärt, alles Beweismaterial werde man in seiner Prager Wohnung finden. Die vier Offiziere, die Redl verhört haben, warten an der Straßenecke auf einen Schuß, stundenlang, nachdem sie, einer nach dem anderen, in ihre Wohnungen gefahren sind, um unauffälliges Zivil anzulegen — vier Stabsoffiziere, die eine Nacht lang in der Herrengasse patrouillieren, würden auffallen.
Der Schuß ist längst gefallen, er war bloß auf der Straße nicht hörbar. Redl liegt tot neben dem Sofa.
Sein Tod wird vor der Öffentlichkeit — und dem Hof! — als Selbstmord in Sinnesverwirrung ausgegeben. Ein Begräbnis in allen Ehren wird vorbereitet — und sogar der Thronfolger eingeladen.
Daß die feierliche Beerdigung, für die alles vorbereitet war, in letzter Minute abgesagt wurde, ist auf einen Schlosser zurückzuführen, der herangezogen wurde, die Prager Wohnungstür Redls und in der Wohnung alle Laden und Schränke zu öffnen.
Die Herren aus Wien, auch sie Dilettanten in ihrem Fach, fragten den Schlosser nicht nach seinem Namen und kamen daher gar nicht auf die Idee, sie könnten es mit einem Schlosser zu tun haben, der deutsch sprach. Sie unterhielten sich in seiner Gegenwart allzu ungeniert über den Fall — wie konnten sie ahnen, daß der Schlosser Wagner ihretwegen ein wichtiges Spiel seiner Fußballmannschaft versäumte, und daß der Obmann dieser Fußballmannschaft zufällig ein Journalist namens Kisch war.
Kisch und sein Chefredakteur taten, was wahrscheinlich alle Journalisten in vergleichbarer Situation täten. Sie brachten die Geschichte in die Zeitung. Da ihre Zeitung andernfalls vor der Auslieferung beschlagnahmt worden wäre, kleideten sie ihre Meldung in die Form eines Dementis — der Pressestaatsanwalt nahm an, daß es aus offizieller Quelle stammte, und ließ es passieren,,
Franz Ferdinand, dessen Verhältnis zum Generalstab ohnehin mehr als gespannt war, erfuhr aus der Presse, daß man versucht hatte, ihn zu hintergehen, und dafür sogar in Kauf genommen hatte, ihn am Begräbnis eines Verräters teilnehmen zu lassen. Vor allem empörte ihn die Pistole als Lösung — aber auch den Thronfolger selbst störte dabei weniger der Verzicht, dem Spion Redl vor seinem Tod möglichst viele Informationen über die russische Spionage in Österreich zu entlocken, als der religiöse Aspekt — es widersprach seiner Denkungsart, einen Menschen, und sei es ein Redl, zum Selbstmord zu zwingen und ohne religiöse Tröstung in den Tod gehen zu lassen (Hennings).
Über dem Fall Redl ging das Verhältnis zwischen Franz Ferdinand und Conrad endgültig in Scherben — da sich der Thronfolger mit seiner Forderung nach Totalreform von Ge-: neralstab und Kriegsschule nicht durchsetzen konnte, blieb einzig Urbanski als Chef des Evidenzbüros, dem Redl unterstellt gewesen war, auf der Strecke. Wie weit es damals mit Österreich bereits gekommen war, erhellt allein schon aus der fast unbegreiflichen und nur aus dem Alter und der Abkapselung des Monarchen erklärbaren Tatsache, daß Urbanski über Verlangen des Thronfolgers in den Ruhestand versetzt, diese Tatsache aber vor dem Kaiser, der Urbanski schätzte, geheimgehalten wurde.
Der „Armeereformator“ Franz Ferdinand aber erreicht zwar seine Ernennung zum Generalinspektor der gesamten bewaffneten Macht, beweist aber auch in dieser Funktion keine glückliche Hand. Die Manöver vom September 1913 bei Tabor geraten unter seiner Leitung zum Skandal, der Thronfolger benimmt sich Conrad gegenüber (wieder einmal) In ( ner unqualifizierbaren Weise, die nur geeignet ist, ihn selbst bloßzustellen, und läßt, statt die Manöver nach militärischen Gesichtspunkten zu Ende zu führen, eine Monster-Kavallerie-Attacke (die „Sophien-Attacke“) reiten, „um seiner Familie, die vom Statthalter Fürst Thun begleitet war, ein glänzendes Schauspiel zu bieten.“
Militärische Führungsfehler verschärften die Folgen des Geheimnisverrates. Die Sophien-Attacke etwa war, so Rudolf Kiszling, „der letzte Großtag der k. u. k. Reiterei.. .Dieses imposante Manöverbild festigte dann noch im Herzen so manches braven Reitersmannes den Glauben an die Unwiderstehlichkeit einer Attacke. Wer aber ein Jahr später nach dem ersten Feldzugsmonat in Galizien den desolaten Zustand unserer Kavalleriedivisionen zu sehen Gelegenheit hatte, mußte sicherlich die Berechtigung der Kassandrarufe zugeben.“