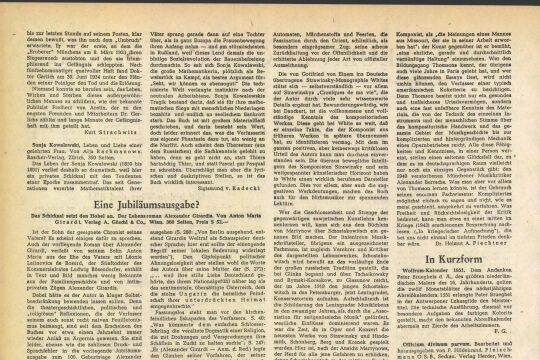Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Schönberg - nur spärlich
Vom Schönberg-Jahr 1974, das an den 100. Geburtstag des Begründers der zweiten Wiener Schule erinnern soll, haben wir bisher wenig zu spüren bekommen. Gewiß, er stand mit der 1. Kammersymphonie auf einem Programm der Philharmoniker, die für den 11. und 12. Mai auch „Ein Überlebender aus Warschau“ angekündigt haben. — Im Musikverein — niente. Dafür hat die Konzerthaus-gesellsohaft einen vierteiligen Zyklus dem „ensemble kontrapunkte“ unter der Leitung von Peter Keuschnig anvertraut, und das Alban-Berg-Quartett spielte im Schubertsaal Schömbergs 1. Streichquartett. Nicht viel, aber doch etwas... Der 3. Abend im erwähnten Schönberg-Zyklus im Mozartsaal brachte nicht nur ein exquisites, sondern auch ein besonders wertvolles Programm, unter dessen Einwirkung vielleicht der oder jener einen Weg zu Schönberg finden mochte.
Zwar gehört der „Das Buch der hängenden Gärten“ auf Texte von Stefan George durchaus zu jenem Kunstbereich, den man als „esoterisch“ bezeichnen muß. Aber diese Lieder üben auch eine spürbare „Direktwirkung“ auf den Hörer. 1909 vollendet und ein Jahr später uraufgeführt, zeigen sie Schönberg auf dem Weg zur vollständigen Auflösung der Tonalität und zum Expressionismus einiger späterer Werke, etwa zu dem Monodram „Erwartung“ und zum Sprechgesang des „Pierrot lunaire“. „Das Buch der hängenden Gärten“ ist vielleicht, was die Interpretation betrifft, das heikelste Werk dieser Übergangsperiode, die in die Reihentechndk mündet. — Die Musik ist so streng stilisiert und konsequent spröde, wie Georges Gedichte. Und das ist wohl das höchste Lob, das man diesem op. 15 spenden kann. — Ein besonderer Reiz besieht darin, daß Gesangstimme und Klavierpart ihre eigenen Wege gehen und nur in einer Parallelaktion zueinander finden.
Die junge englische Sopranistin hat ihren Trapezakt mit Können und Eleganz absolviert. Die Stimme — nun ja: sie gilt als besonders für die Interpretation von Neuem und Neuestem geeignet. Jane Manning sang rein und richtig, mit viel Einfühlung und Intensität, ohne allerdings orphischen Wohllaut zu verbreiten (aber jenen Sängerinnen und Sängern, die auch diese Qualität mitbrächten, hüten sich vor so schwierigen und zeitraubenden Studien). Voll befriedigend: Howard Shelley am Flügel: korrekt, sensibel, klangschön.
Dem neugegründeten Schö'nberg-Kammerchor, der unter der Leitung von Erwin Ortner den zwei Jahre früher, also 1907, entstandenen Chorsatz „Friede auf Erden“ ausdrucksvoll sang, kann man bestätigen, daß er nicht distoniert hat (denn nach spätestens der zweiten Strophe hat das bisher jeder uns bekannte Chor getan, der ohne instrumentale Stütze arbeitete).
Die das Konzert beschließende 2. Kammersymphonie hat ihre Geschichte. Die ersten Entwürfe gehen auf die Zeit der 1. Kammersymphonie zurück, die sich ja in den Konzertprogrammen auch konservativerer Vereinigungen einen festen Platz erobert hat. Dann hat Schönberg das 1906 begonnene Werk immer wieder vorgenommen, 1908, 1911 und 1916. Aber erst 1939, bereits in der Emigration befindlich, hat er es vollendet. Es wäre ein Jammer, wenn er diese Partitur, hätte unvollendet liegen lassen. Denn es ist ein überaus reizvolles Werk, genau in der Mitte zwischen spätromantischer Tonalität und „freier“, bereits ihre totale Aufhebung ahnen lassend. Das kleine Ensemble mit seinen zwölf Bläsern und zehn Streichern hat auch eine wunderbare Klangbalance.
Allen sei gedankt für diese subtile Wiedergabe, über die Peter Keuschnig in jeder Sekunde wachte, der sich mit der Interpretation gerade dieses Stückes wieder einmal von seiner allerbesten Seite gezeigt hat und dem wir wahrscheinlich auch die „Komposition“ dieses mustergültigen Programms zu danken haben. Helmut A. Fiechtner
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!