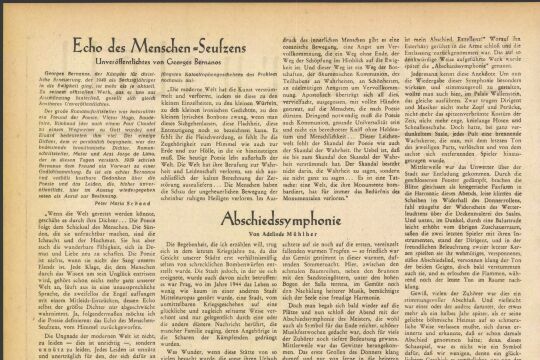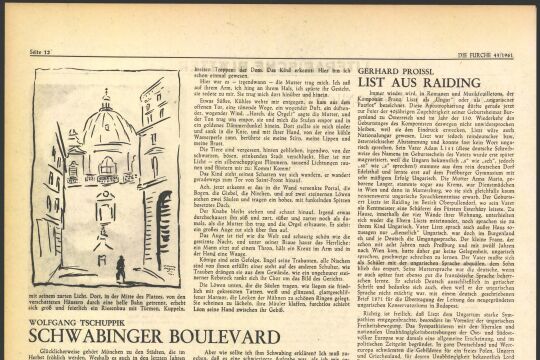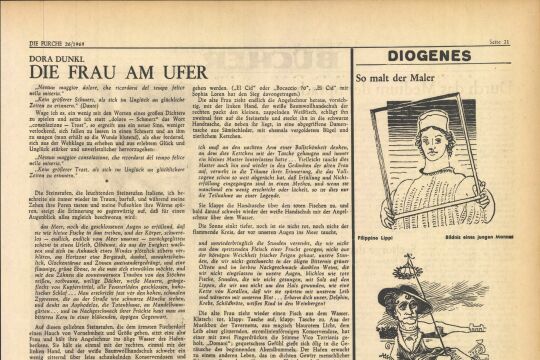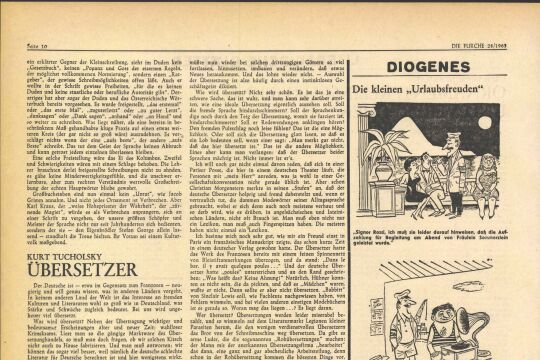Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Stunde der guten Geister
Die Stunde lockt, der Geist weitet sich, sucht nach Nahrung; die leichte Müdigkeit, die den Körper mehr umspielt als erfaßt hat, fordert keinen Schlaf, im Gegenteil: Dieses wohlige Nachlassen physischer Spannkraft gegen neun Uhr abends setzt die Neugier in Bewegung. Etwas muß unternommen werden, etwas Erregendes und zugleich Sanftes, das wohl Neues erschließt, den Kreis der Vertrautheit aber nicht überschreitet.
Neugier ist nicht das richtige Wort; das Gefühl beginnt festere
Form zu gewinnen, es ist erfüllt von einer Erwartung, die sich allerdings auf eine Wiederholung richtet, auf ein verschüttetes Erlebnis aus früherer Zeit, und die Erinnerung steigt tatsächlich ins Bewußtsein. Das Bild ist klar. Endlich begreifen wir, es ist an der Zeit, einige längst zur Seite geschobene Bücher wieder aufzuschlagen.
Sie sind wirklich da, sind nicht endgültig abhanden gekommen, halten sich auch nicht versteckt, man kann sie, eines nach dem anderen, aus der Buchreihe des Regals ziehen: die stämmige Dünndruckausgabe des Michel de Montaigne, das unscheinbare Taschenbuch mit den Schriften Epi-kurs, den großen blauen zweisprachigen Apollinaire, dann den Proust, „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“, Band eins, und endlich auch das zerlesene Exemplar von Goethes Gesprächen mit Eckermann, dieses aber vorsichtig, denn zwischen letzter Seite und Einband stecken vergilbte Zettel aus früheren Jahren, vollgeschrieben mit Notizen.
Ein wenig staubig sind sie, die längst nicht durchgeblätterten Bücher, man müßte wohl aufstehen, ein Staubtuch holen, über das Papier streichen, auch die eigene Hand säubern, aber das Lesen duldet keine Verzögerung, also werden die Finger am Hosenbein abgestreift und der Band Goethes, der obenauf hegt, gleich aufgeschlagen.
Da stehen sie tatsächlich, die vertrauten Sätze; manche wärmen mit der milden Kraft alter Freundschaft, andere scheinen in der Zwischenzeit einen neuen Sinn erhalten zu haben, und viele sind gänzlich unbekannt, man hat sie vergessen oder liest sie in der Tat zum ersten Mal. Doch wirken nicht nur die Sätze. Das Buch hat in all den Jahren einen Hauch des Geruches von Papier und Druk-kerschwärze beibehalten, oder der leichte Duft, den wir wahrzunehmen glauben, ist bloß Halluzination, ferne Erinnerung an den Tag, an dem wir den Band im Bücherladen erstanden, nach Hause gebracht und sogleich aufgeschlagen haben.
Es ist aber nicht nur der Geruchssinn, der geweckt wird; die Hand erinnert sich noch an den ersten, der Buchform und dem Gewicht angemessenen Zugriff, auch an die Berührung des Papiers beim Blättern. Die kleinen Lettern des Montaigne und die noch kleineren der Fußnoten sind alte Bekannte, und wie elegant ist der schmale Satzspiegel des Proust geblieben! Die unscheinbare Typographie des Epikur paßt zur Schlichtheit dieses guten und redlichen Denkers — man hatte es bereits damals, bei der ersten Lektüre, bemerkt und entdeckt es nun wieder.
Am aufwendigsten ist der Apollinaire. Die langen Verszeilen brauchen das breite Format, und die Buchstaben des Gedichts „Springbrunnen“, in der Form eines Springbrunnens angeordnet, drängen in die Höhe. Aufregend ist es, ab und zu das Original mit der deutschen Ubersetzung zu vergleichen, über die Mängel zu grübeln, sich über eine geglückte Lösung und ab und zu über einen Volltreffer zu freuen.
Im Goethe fällt der Blick auf die Handschrift der Marginalien früherer Jahre. Was war uns aufgefallen und warum? Das Schriftbild wirkt das eine Mal unreif, das andere Mal geziert. Manches wurde offenbar hastig hingekritzelt. Hatten wir Angst, der Einfall könnte uns augenblicklich entgleiten? Die Notizen, die die eingeschobenen Zettel füllen, zeugen von einem Leser, der oft dummes Zeug zu Papier brachte, ab und zu aber geradezu geistreich gewesen ist. Auch findet sich irgendwo ein Satz, den wir seither in verschiedenen Gesprächen immer wieder ausgesprochen haben, nach außen hin ruhig, innerlich wegen der Wiederholung leicht beschämt. Siehe da: In dieser Kritzelschrift wurde er zum ersten Mal formuliert. Seither gehört er zum gesicherten Fundus. An seiner Gültigkeit wird nicht mehr gerüttelt. Er ist gleichsam zur Gewohnheit geworden.
Die Nächte bei solcher Lektüre sind kurz. Für Epikur, für Montaigne, für Goethe hat zur Morgendämmerung noch der Hahn gekräht. In der Stadt ist es still, die Straßenbeleuchtung draußen und das elektrische Licht hier drinnen verlängern die Nacht.
Irgendwann einmal beginnt die Schläfrigkeit den Blick zu trüben, und wir gehen im Zustand eines seltsam nüchternen Rausches zu Bett, voll der Erinnerungen und doch von einer Leichtigkeit erfüllt, die uns hebt und mit der gleichen Leichtigkeit früherer Tage verbindet. Das Vergangene ist gegenwärtig, die Gegenwart ist nur ein Traum, und die guten Geister der vertrauten Autoren wachen über unseren Schlaf.
Aus dem Buch „Das Leben als schöne Kunst“, das im Herbst im Kreuz-Verlag, Stuttgart, erscheint.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!