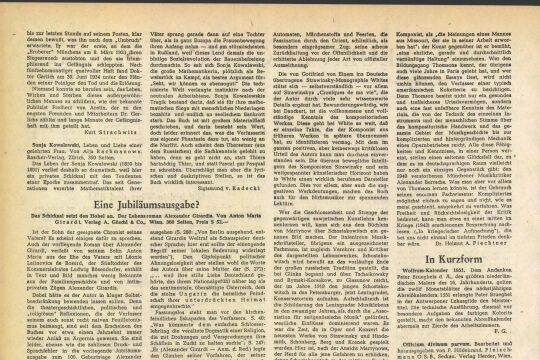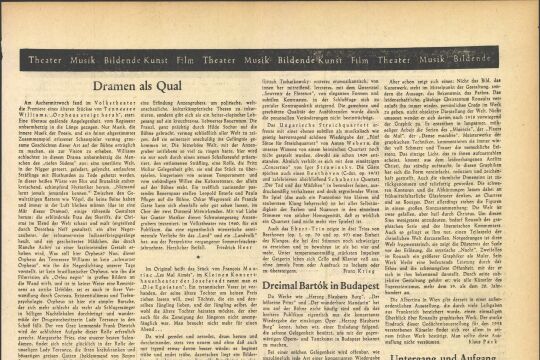Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Vorwiegend polnisch
Karol Szymanowski, 1882 in Warschau geboren und 1937 ln Lausanne verstorben, gehört zu den hierorts zu Unrecht vernachlässigten Komponisten. Er hielt sich vor 1918 viel im Ausland auf und geriet in Berlin, Leipzig und Wien unter den Einfluß der deutschen Musik, von dem er sich später zugunsten der französischen Impressionisten und vor allem Skrjabins befreite. In der 1909 bis 1910 geschriebenen Zweiten Symphonie dominieren noch durchaus der Tristansche Chromatismus, Max Reger und der Strauss der symphonischen Dichtungen. Aber im ekstatischen Ausdruck findet Szymanowski schon zu sich selbst und gelangt in Skrjabin-Nähe. — Das zweisätzige 33 Minuten dauernde Werk besteht aus einem Sonatenhauptsatz, der eigentlich ein Tangemälde ist, und aus einer Reihe von fünf Variationen (die am schwächsten geraten sind) nebst einer Fuge mit fünf Themen. Szymanowski, der immer ein wenig zur Hypertrophie sowohl des Gefühls wie der orchestralen Mittel neigte, hat 25 Jahre später die Riesenpartitur reduziert, wahrscheinlich sehr zugunsten des Gesamteindrucks. Hypertrophie der Mittel kennzeichnet auch Alban Bergs Orchesterlieder nach Ansichtskartentexten von Peter Altenberg. Das 80-Mann- Orchester begleitet 12 Minuten lang fünf sentimental-verschmockte Text fragmente („Sahst du nach dem Gewitterregen den Wald?!?!… Siehe, Fraue, auch du brauchst Gewitterregen!“). Aber Berg hat 1912 eine überaus differenzierte, in allen Far- , ben schillernde, hochexpressive Musik dazu geschrieben und die Singstimme zum erstenmal so geführt wie später im „Wozzeck“. Der Pole Andrzej Hiolski sang den überaus heiklen Part mit Vorsicht und Einfühlung, aber leider mit glanzlos- rauher Stimme.
Im gleichen Jahr, 1913, als in Paris Strawinskys „Sacre“ und in Wien Bergs Altenberg-Lieder ausgepflffen wurden (beidemal mußte die Aufführung abgebrochen werden), kam in Warschau Witold Lutoslawski zur Welt. Er hatte frühzeitig Erfolg und wurde seit 1948 mit den höchsten nationalen und internationalen Preisen ausgezeichnet, u. a. mit dem der UNESCO und der Wiener Gesellschaft der Musikfreunde sowie 1967 mit dem Gottfried-von-Herder-Preis. Ein Jahr später schrieb er für die westfälische Stadt Hagen ein „Livre pour orchestre“. Das 22 Minuten dauernde Stück besteht aus genau notierten und improvisatorisch freien Abschnitten. Die vier „Kapitel“ sind durch drei Intermedien voneinander getrennt, die jeweils von verschiedenen Orchestergruppen mit „lockeren“ Improvisationen ausgefüllt werden und für Dirigent und
Publikum zur Entspannung dienen sollen, wobei der letztere in Ruhestellung verharrt. Trotz dieser Unterbrechungen folgt man der Musik mit äußerster Spannung, bewundert das kompositionstechnische Können, die Phantasie und das Raffinement des Autors ebenso wie seine bewußt und kalkuliert gesetzten Effekte. Das macht ihm, mit solcher Meisterschaft, keiner der Jüngeren nach.
Der Dirigent Henryk Czyz ähnelt äußerlich einem Leichtathleten vom russischen Staatszirkus. Den 1. Satz der Szymanowski-Symphonie hat er zwar mächtig angeheizt, aber doch vielleicht ein wenig mißverstanden. Die komplizierte Partitur Bergs interpretierte er sehr sorgfältig, mit allen ihren schillernden Farben und Zwischentönen. Eine Paradeleistung war die Wiedergabe der Komposition von Lutoslawski: ohne Partitur und mit einer Souveränität, die auch im Orchester Sicherheit bewirkte. Noch selten haben wir das ORF- Orchester so lebhaft, engagiert und animiert musizieren hören. Es wäre sehr interessant, dieses den langjährigen Durchschnitt weit überragende Stück bald wieder zu hören, etwa von den Wiener Symphonikern. (Das besprochene Konzert wird am 10. Mai um 20 Uhr im Programm ö I gesendet.) Helmut A. Fiechtner dynamischen und rhythmischen Zündfunken im „Allegro giocoso“ aufgeladen, nicht nur die Hände, sondern die Bewegungen des ganzen Körpers als vorantreibende Kräfte gebrauchte. — Das Hauptinteresse des Abends konzentrierte sich aber auf Benjamin Brittens in Wien nur selten aufgeführte „Symphonie für Violoncello und Orchester“. Der Titel bestätigt die — nach dem Anhören des Stückes zutreffende — Annahme, daß es sich hier auf Grund der Form und des Aufbaues sowie der weitgehenden Beteiligung des Orchesters tatsächlich um eine Symphonie handelt, das Werk aber zufolge der virtuosen und kan- tabalen Stellen des Cellos gleichzeitig als ein Konzert für dieses Instrument anzusehen ist. Bei aller Wertschätzung des Komponisten ist jedoch festzustellen, daß ihm dabei nichts Bedeutendes gelungen ist. Versöhnend wirkt nur der Adagio- Satz mit seiner ausdrucksvollen Cellokantalbilntät und den irisierenden, debussyartigen Orchesterzwischenspielen. — Anja Thauer, die 26jährige Cellistin, erwies sich als Solistenphänomen mit prachtvollem Ton auf einem ebenso prachtvollen Instrument, als Meisterin mit grandioser Lauftechnik und einem selten klangvollen Pizzikato, einer resoluten, männlich-kraftvollen Bogenführung und einem wunderbar singenden Legato. Sie wurde mit Recht gefeiert, aber auch die Wiener Symphoniker und der Dirigent hatten verdienten Erfolganteil.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!