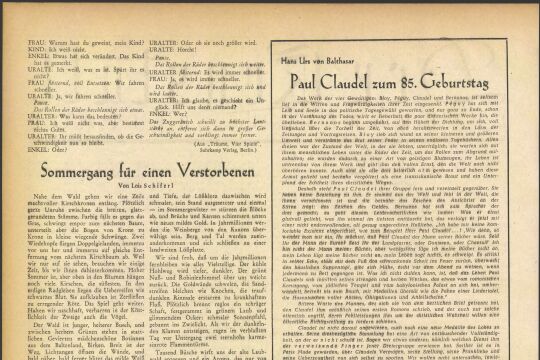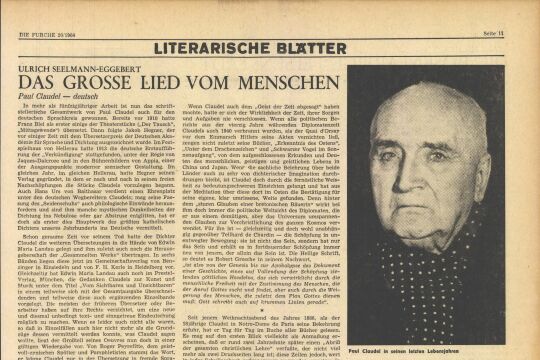Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Wanderer zwischen zwei Welten
„Was kümmert mich Erde und All und dieses ganze Fabel-gefüllsel? Wenn Gott dort ist und ich des Geschehnisses stiller Betrachter. Ich weiß, meine Nacht ist es nicht, das Licht allein ist das Wahre. Die kraftlose Sonne in mir will hervorgehen aus dem, was ist.“
In einem Gedicht, „Die Verwandlung“, hat Paul Claudel diesen Tag wachgerufen, das Fest der Verklärung auf dem Berge Tabor, an dem er am 6. August 1868 zur Welt kam, wie er es ausmalend darstellt, um 11 Uhr, während die Glocken zum Hochamt läuteten. Vermutlich war es aber um 4 Uhr in der Früh. Im einstigen Pfarrhaus von Villeneuve-sur-Fere-en-Tardenois im Departement Aisne, ganz im Schatten der Kirche. An der Kärglichkeit dieser Behausung ist nichts verändert worden, heute ist dort ein Claudel-Museum eingerichtet. Noch immer steht das kleine Glockengeläute auf dem Hochdach der Dorf kirche, ein Turm ist es nicht, etwas schief. Wer, von Paris kommend, das Dorf aufsucht, sieht die Schilderung bestätigt von diesem leicht zur Seite geneigten Ozeandampfer, der sich, gegen den Sturm ankämpfend, die Ausfahrt aus dem Hafen erzwingt. Sinnbildhaft für den Lebensweg des 'Dichters, der unter dem Schutz dieser Dorfkirche seinen Anfang nahm und der ihn auf seiner Diplomatenlaufbahn auf alle Meere der Welt und in die Länder aller Kontinente führen sollte.
Aus diesem Boden, aus dem engen Alltagsdasein der ihn umgebenden Mitmenschen vollzieht er einen doppelten Schritt in seinem Leben und in seinem Werke. Meine Heimat ist die Welt, ist das Universum, hätte Paul Claudel sagen können, auch wenn er sich bis zu seinem Lebensende mit Freude und Stolz auf seine engere Heimat im Tardenois berief. Der Ruf der Horizonte, den der Knabe in der dörflichen Umgebung vernommen hatte und in den sich der Klang der lautlosen Posaune mischte, die aus einer anderen Welt Violainens Vater Anne Vercors („Verkündigung Maria“) in die Ferne rief, sollte in ihm nicht zum Verstummen kommen. Um diese Grunderfahrung geht es ihm, auch wenn er zum Beispiel seine Kunstbetrachtungen unter dem zunächst befremdlichen Titel „Das hörende Auge“ vereinigt. Das innere Auge allein ist damit nicht gemeint. Auch dieses erfüllt seine Sehfunktion, indem es Erschautes auf einen imaginierten Bildschirm projiziert und damit der Einbildungskraft in bildhafter Faßlichkeit übermittelt. Aus dem Innern bahnt sich da etwas den Weg nach außen. Dagegen möchte der Dichter zeigen und dazu anleiten, die mit dem Auge erfaßte Außenwelt in Innenwelt zu verwandeln. Vielleicht, daß der schmale Grenzstreifen, durch den Kunst und Betrachtungen getrennt und zugleich zusammengehalten werden, den Weg erkennbar machen kann. Denn auch die Kunst, vornehmlich als eingegebene Äußerung menschlichen Geistes, ist für Claudel wie die Schöpfungswelt Künderin einer verborgenen Botschaft. Im Schöpferischen, im Kreativen ist sie einbezogen in den unablässig bis an das Ende aller Zeiten weiterwirkenden Schöpfungsprozeß und spricht von ihm in Zeichen ,zu uns. Der läßt sich nur erschließen auf dem Wege vom Sichtbaren zum Unischtbaren, von der Vordergründigkeit zur Hintergründigkeit. Ein solcher Durchblick ins Unendliche, wie er sich auf einem unscheinbaren holländischen Bilde zeigt, das „einen ganz geraden, häßlichen Weg zwischen zwei Reihen schrecklicher, vom Winter zerquälter und zerfetzter Bäume in einer ebenen Landschaft“ darstellt, entlockt ihm den Ausruf: „Wahrlich, ich habe gesiegt, ich habe den Horizont durchstoßen.“
Ist das nicht das Thema seines ganzen Werkes, des dramatischen zuallererst? Den Horizont zu durchbrechen, damit uns die Botschaft von jenseits erreicht. Solch unstillbares Verlangen erfüllt alle Helden seiner Dramen, von Goldhaupt angefangen über Mesa, Anne Vercors, Orian, Ro-drigo bis zu Christoph Columbus und dem jungen Tobias, der von jenseits des Horizontes das Licht heimholt, anders gesagt: die Botschaft des Lichtes, die den Menschen dort erwartet. Und nichts anderes meint er, wenn er davon spricht, wie in den Jahren der Bedrängnis, yoti/.seiner Erleuchtung am. Weihnachtstag von 1886 in Notre-Dame de Paris, Beethoven und Wagner für ihn die einzigen Strahlen der Hoffnung und des Trostes waren.
Er selbst aber, der unermüdliche Gottsucher, weiß, daß Gott nur in einem Buche zu finden ist, in den Heiligen Schriften. Auf sie hin ist die Blickrichtung bei all seinen Erkundungen gelenkt. Er interpretiert nicht in das Geschaute hinein sein eigenes Ich, sondern liest überall wie ein verwundertes Kind in einem aufgeschlagenen Bilderbuch. Nachdem er sich die Augen vollgesogen hat mit dem, was die Welt an Schauspielen zu bieten hat, wendet er sich der Bibel zu, als deren Stammgast er sich bezeichnet. Die letzten dreißig Jahre seines Lebens hat er der Erkundung, der Befragung der Heiligen Schrift zugewandt. Es läßt sich leicht erkennen, daß alles in seinem Werk auf diesen Wendepunkt am Abend seines Lebens zulief. Die dichterische Form aber, dieses Bekenntnis zu der anderen Welt, auf das das ganze Werk abgestimmt ist, findet den reinsten Ausdruck im Lobgesang, der in den Augen Clau-dels vielleicht die größte Antriebskraft der Dichtung überhaupt ist, weil er der Ausdruck des tiefsten Bedürfnisses der Seele ist. Sein letztes Wort, ehe er den Schritt hinüber tat, „ich fürchte mich nicht“, dem hatte er in seinem Lobgesang auf den „Strom“ bereits Ausdruck ver-
„Wer das Auge erhebt zu dir, der fürchtet nicht, schwanken könnte der Fuß, auch nicht schwindelnden Wirbel.
Ob es Wald nun ist oder Meer oder Nebel selbst und Regen und der wechselnde Anblick der Lande. Wer dein Antlitz erschaut, dem wird alles begreiflich im güldenen Licht.“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!