Nicht ganz an den Salzburger Festspielerfolg konnte die nun an der Wiener Staatsoper gezeigte "Ariadne“ anschließen. Zu sehen war allerdings nicht die Ur-, sondern die übliche Zweitversion.
Für viele war es neben Zimmermanns "Soldaten“ die wichtigste Musiktheaterproduktion des letzten Salzburger Festspielsommers: die in ihrer Erstfassung gezeigte "Ariadne“ von Richard Strauss. Vor allem das Vorspiel entzückte. Zum einen durch die trefflichen Schauspielerleis tungen von Cornelius Obonya als mitreißendem Monsieur Jourdain und Peter Matic als idealem Haushofmeister. Zum anderen durch die auf die schauspielerischen Akzente dieses Opernabschnitts konzentrierte pointenreiche Inszenierung von Sven-Eric Bechtolf. Demgegenüber fiel - bei allen Meriten von Emily Magee als Primadonna/Ariadne, der brillanten Elena Mosuc als Zerbinetta und dem bei diesem Rollendebüt nur partiell überzeugenden Jonas Kaufmann als Tenor/Bacchus - der zweite Teil etwas ab. Was an der wenig inspirierenden Leitung von Daniel Harding lag, der nach einiger Dirigentensuche den ursprünglich vorgesehenen Riccardo Chailly, der krankheitshalber absagen musste, schließlich ersetzte.
Mythos und Realität
Jetzt ist diese "Ariadne“ an die Wiener Staatsoper, mit der sie koproduziert wurde, übersiedelt. Knapp vor Weihnachten hatte sie Premiere. Eine übliche Koproduktion ist es nicht, weit eher eine auf dem ersten Konzept aufbauende Weiterentwicklung. Denn im Haus am Ring wird nicht die Erstfassung, sondern die gängige Zweitversion gespielt. Angeblich weil die Urform nicht repertoiretauglich sei. Vor allem die höheren technischen Anforderungen für die Zerbinetta werden dafür gerne als Argument angeführt.
Tatsächlich präsentiert die Wiener Rollenbesetzung, Daniela Fally, ihre Koloraturen bei aller dabei immer wieder gezeigten Sicherheit noch nicht mit jener Leichtigkeit und Grandezza wie im Sommer ihre Kollegin in Salzburg. Auch für die Primadonna/Ariadne hat man mit der introvertierteren, vokal kräftigen Krassimira Stoyanova auf einen sehr anderen Sängertyp als in Salzburg gesetzt. Aber auch Sven-Eric Bechtolfs Inszenierung zielt auf andere Schwerpunkte. Er hebt vor allem die gewollte Widersprüchlichkeit des zweiten Teils hervor, macht so deutlich, wie scheinbar unlösbare Konflikte doch noch praktikable Lösungen erfahren. Dieser Grundidee ordnet er seine so unaufdringliche wie bis ins Detail ausgeklügelte Personenführung unter. Mythos und Realität können damit klug nebeneinander bestehen.
Wie in Salzburg bestechen Rolf Glittenbergs großzügig-elegante Bühnenbilder. Sie wirken allerdings anders als in der intimeren Atmosphäre des Hauses für Mozart. So lässt die hochragende Bühnenarchitektur des Vorspiels nun eher an einen modernen Bungalow als einen Salon denken. Dafür bringen die zerborstenen Klaviere, die das in einen Zuschauerraum mündende zweite Bühnenbild dominieren, die Idee der Wüstenlandschaft markanter zum Ausdruck als in Salzburg. Auch den Protagonisten merkt man an, dass sie auf der Staatsopernbühne mehr Platz und damit mehr Freiheit zum Agieren haben.
Wiener Strauss-Affinität
Dass Peter Matic wieder ein exzellenter Haushofmeister sein würde, war vorherzusehen. Nicht in bester Verfassung zeigte sich der zuweilen tremolierende Jochen Schmeckenbecher als Musiklehrer. Makellos, stets bombensicher agierte Stephen Gould in der Doppelrolle Tenor/Bacchus. Adam Plachetka gab einen rollendeckenen Harlekin, stimmig besetzt waren Scaramuccio, Truffaldin und Brighella, um nichts standen ihnen die drei Nymphen - auch hier handelte es sich um Rollendebüts - nach. Was auch immer dafür spricht, den Komponisten mit einem Sopran zu besetzen, Christine Schäfer verfügt nicht über das entsprechende Volumen, wirkte selbst in den leisen Orchesterpassagen stets angestrengt, war damit die Enttäuschung dieses Abends.
Ungleich stärker, dynamisch wie klanglich differenzierter als in Salzburg vermochte das von Franz Welser-Möst souverän befehligte, mustergültig studierte Orchester seine Qualitäten, nicht zuletzt seine spezifische Strauss-Affinität auszuspielen, auch wenn es nicht gelang, die Spannung den Abend über gleichmäßig durchzuhalten.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!

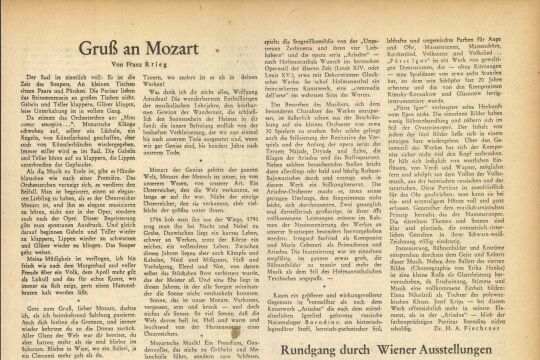




















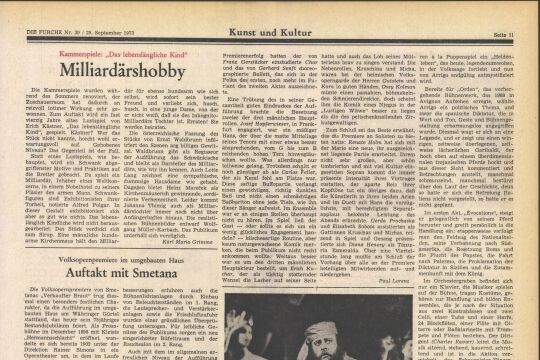



















































%20OFS_Monika%20Rittershaus%20(16).jpg)




















_edit.jpg)


