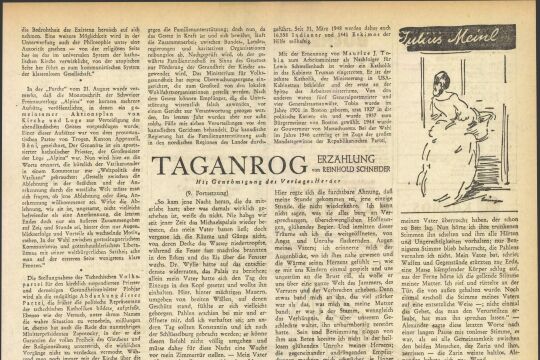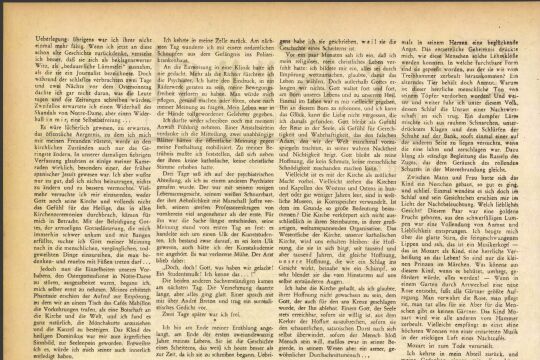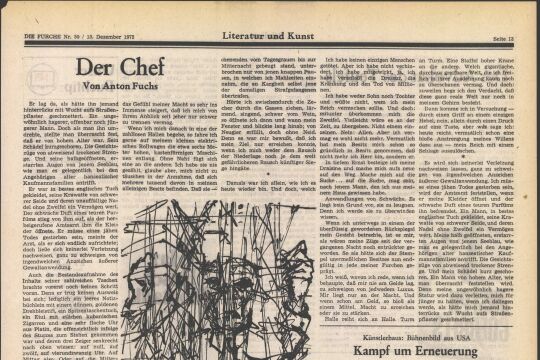Hört zu!
DISKURS
Geräusche der Ungleichheit
Wie klingen Armut und Tristesse? Kann man dem Stress seiner Vorfahren nachhorchen? Unser Autor erinnert sich an die Klangkulissen seiner Herkunft – und rekonstruiert die „Soundscapes“, die er heute hinter sich gelassen hat.
Wie klingen Armut und Tristesse? Kann man dem Stress seiner Vorfahren nachhorchen? Unser Autor erinnert sich an die Klangkulissen seiner Herkunft – und rekonstruiert die „Soundscapes“, die er heute hinter sich gelassen hat.
Heiseres Husten; Nachbarn, die streiten; der Pissstrahl eines im Stehen pinkelnden Nachbarn durch die zu dünnen Wände; Sirenen; das markerschütternde Einrammen einer Tür zu Beginn einer Hausdurchsuchung; das Klatschen einer Ohrfeige; das dumpfe Bersten einer eingeschlagenen Zimmertür; quietschende Bahnschienen; lauter Verkehr; Schreie während einer Schlägerei im Treppenhaus. So hörte sich die Armut an, in der ich aufgewachsen bin.
Zumindest erinnere ich sie so. Ich schreibe nur von meiner Armut, da die oben beschriebenen Geräusche und Töne nicht unbedingt die Armut anderer wiedergibt. Ein Geräusch der Armut, das kann in einem anderen Fall das Klavier sein, an dem der entlassene Akademikervater seiner Tochter Beethovens 5. Symphonie vorspielt. Es kann das Knurren der fetten Katze sein, dessen Besitzerin lieber verhungern würde, als am Futter ihres Haustiers zu sparen.
Unverdaute Töne
In meinem Leben haben Geräusche, Töne – und ihre Abwesenheit – eine große Rolle gespielt. Die Abwesenheit von Geräuschen ist dabei nicht automatisch Ruhe, sie ist eine Stille. In der Stille kann Erlebtes nachhallen und einen verfolgen. Alle um einen herum hören nichts; man selbst aber lauscht mit seiner Ohrmuschel einer vergangenen und unverdauten Geräuschkaskade hinterher.
Wenn von Geräuschen der Ungleichheit die Rede ist, dann ist auch die Abwesenheit von Geräuschen eine ungleiche Stille. Auf der einen Seite ist da die bürgerliche Stille. Diese Art von Stille ist eine saturierte, eine gut verdauliche Stille. Sie wird kultiviert, sie kann ein eigener Programmpunkt am Wochenende sein, der nur vom Geräusch des Umblätterns der Wochenzeitung oder von kleineren Verdauungsseufzern unterbrochen wird.
Und dann gab es unsere Stille, die Stille meiner Kindheit und Jugend. Genau genommen war es in mir gar nicht still, und auch die Wohnung, in der wir lebten, war selbst im Zustand der Stille ein von Vorwürfen und Bitterkeit umhüllter Ort, der so laut schallte, dass es manchmal kaum auszuhalten war. Es war eine Stille der Projektion, wo alles, was sich im Außen abspielen sollte, schon gesagt, vorgeworfen, hinausgeschrien wurde. Es war eine Stille nach den Worten. Seit meiner Kindheit herrscht ein Regime der Unruhe in mir. Meine Mutter gab mir den Namen Olivier, der im Französischen Olivenbaum bedeutet. Diese Bäume haben tiefe Wurzeln und werden oft hunderte Jahre alt. Sie werden mit Beständigkeit, Frieden und Ruhe assoziiert. Umso überraschter war meine Mutter, als sie merkte, was für ein Kind sie ausgetragen hatte: Ich war das Gegenteil von allen Zuschreibungen, mit denen man Olivenbäume belegt. Aber wie sollte das Bäumchen wachsen, unter so widrigen Bedingungen?
Über die Muttermilch wurde ich mit dem Stress meiner Ahnen gestillt. Mit dem Leid meines Großvaters, der im Konzentrationslager saß. Mit der Furcht meiner Mutter, die unter seiner Gewalt litt. Mit der Angst meiner französischen Großmutter, die sich in Tunneln vor den Bomben der Alliierten im von Nazis besetzten Frankreich versteckte. Mit dem Zorn meines Vaters, dem das Handwerkszeug fehlte, ihn in gesunde Bahnen zu lenken.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!