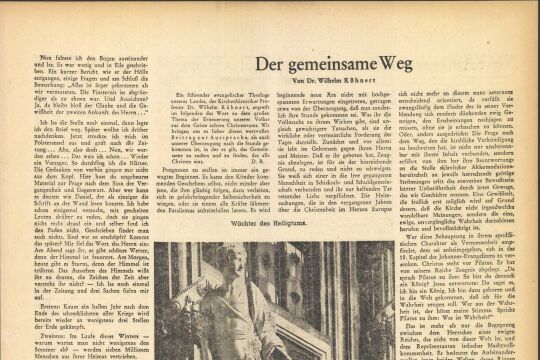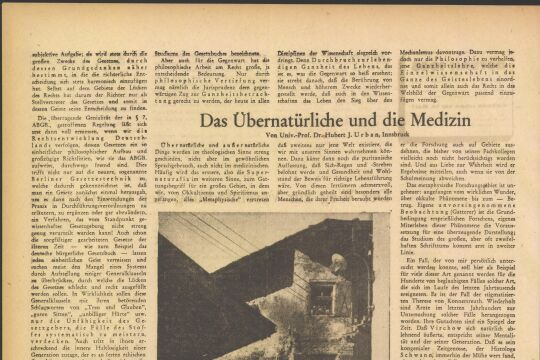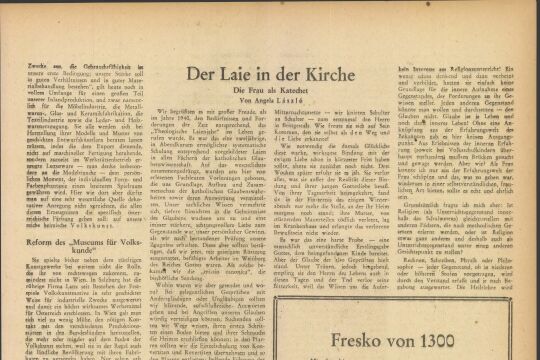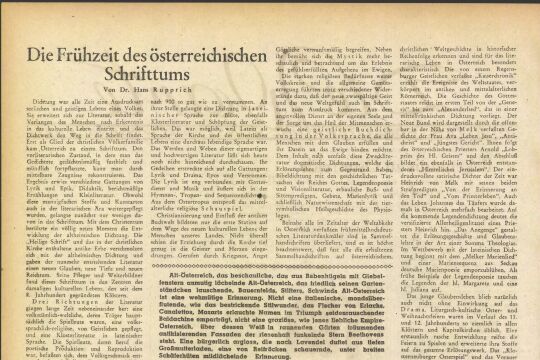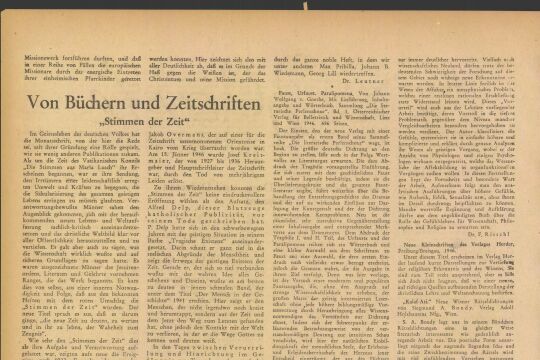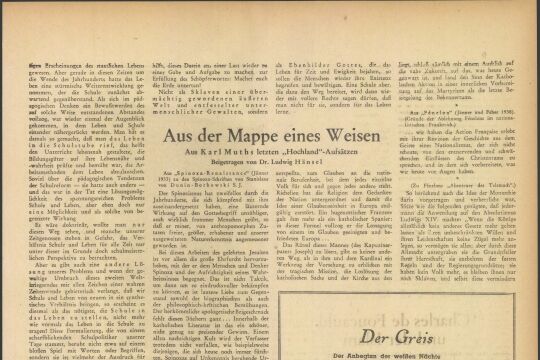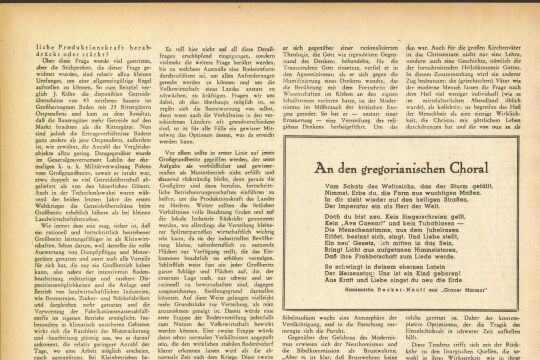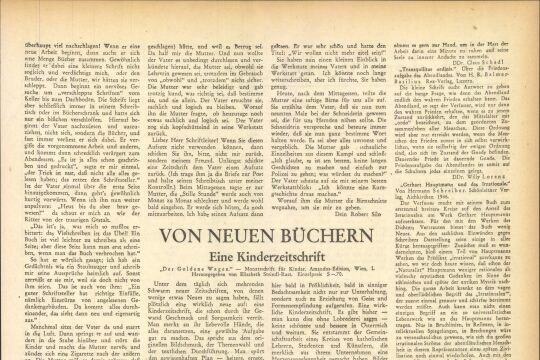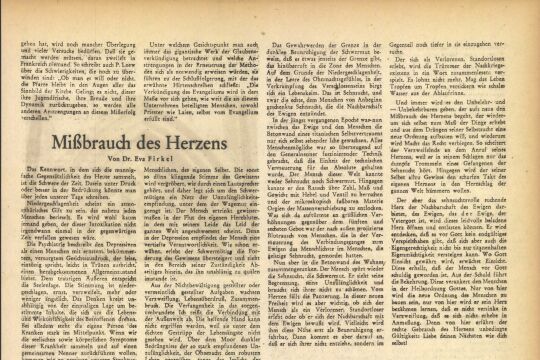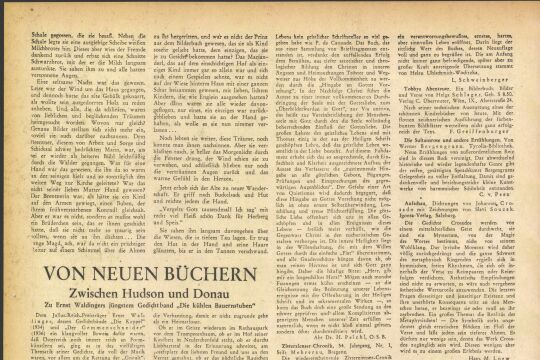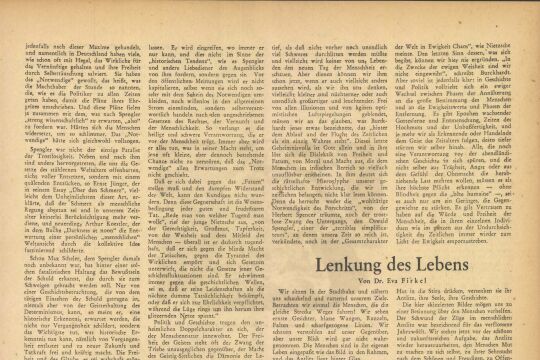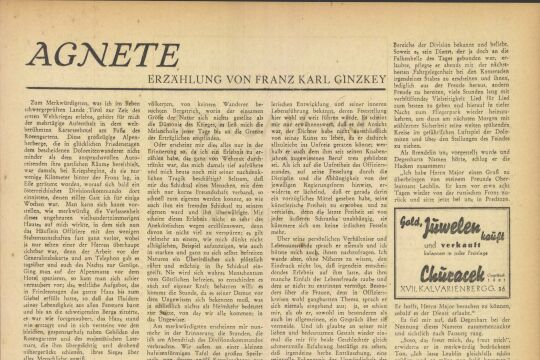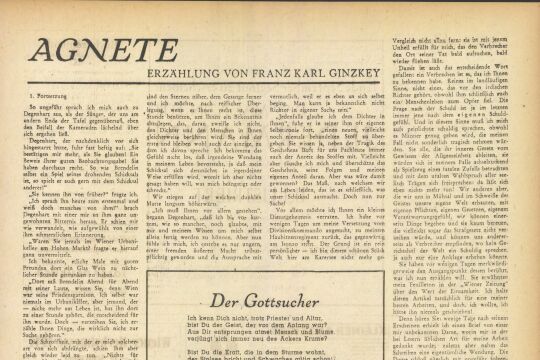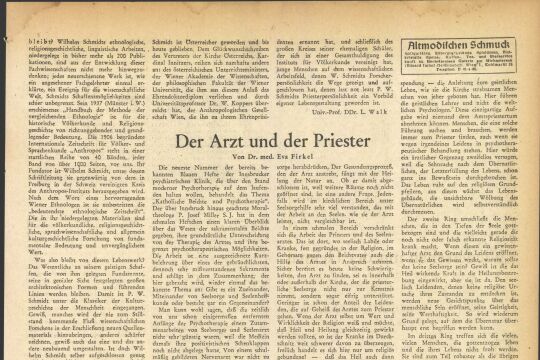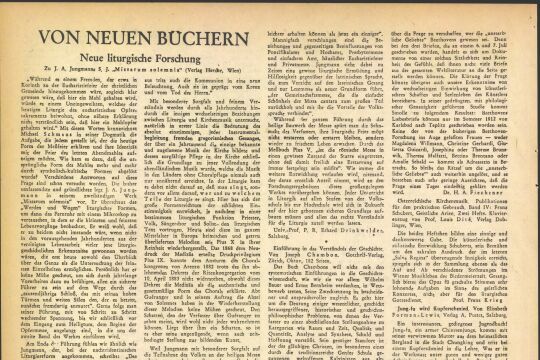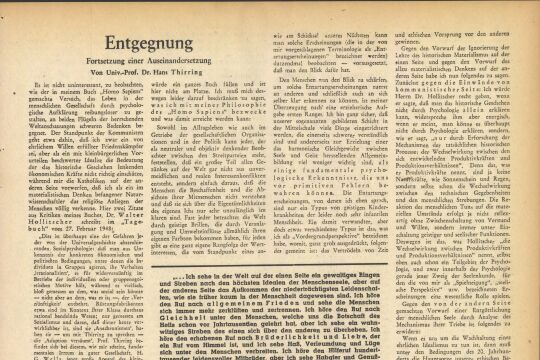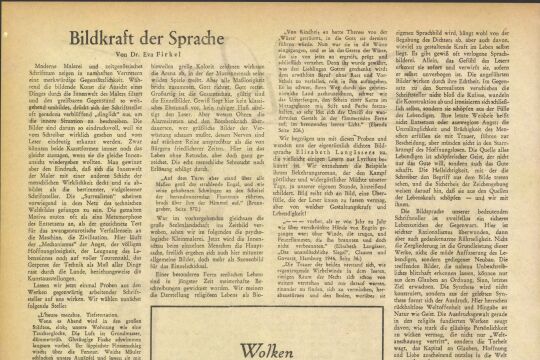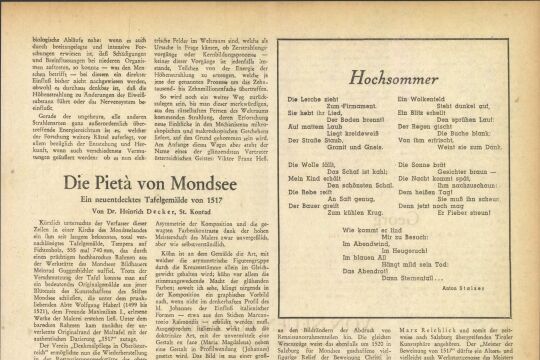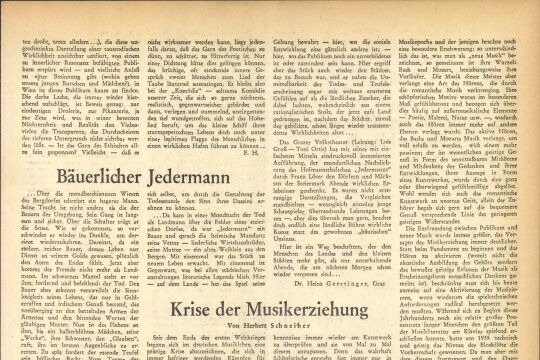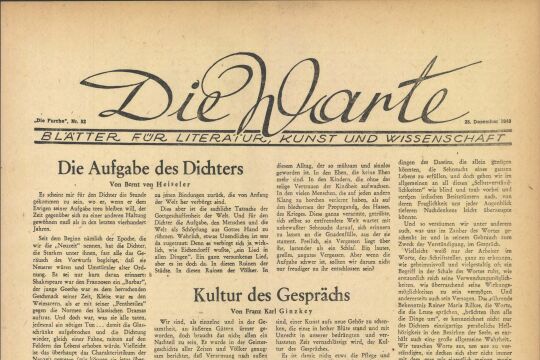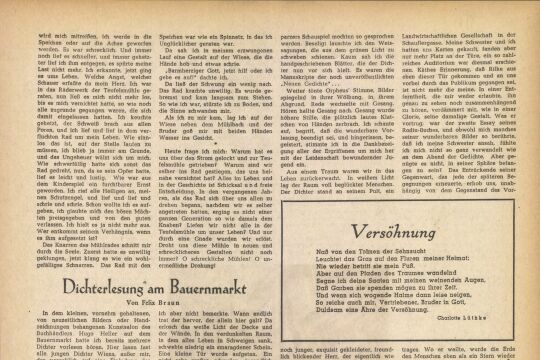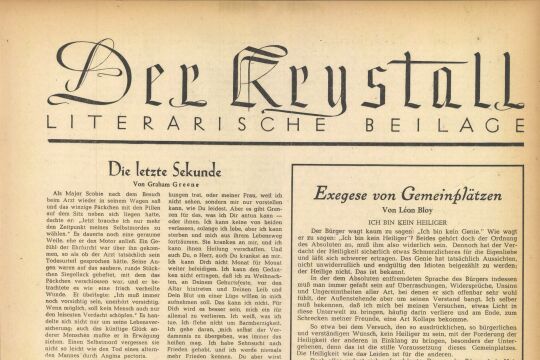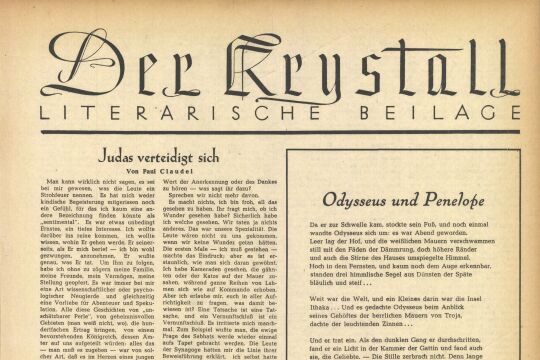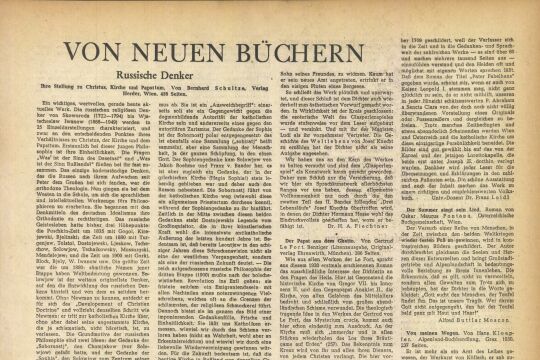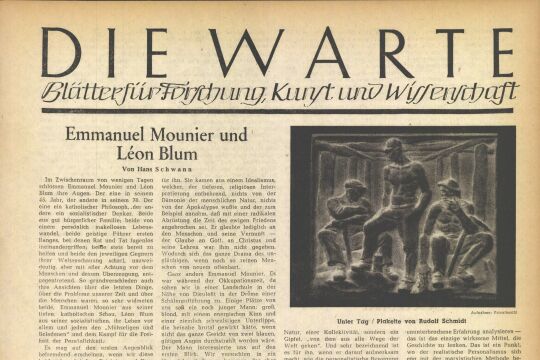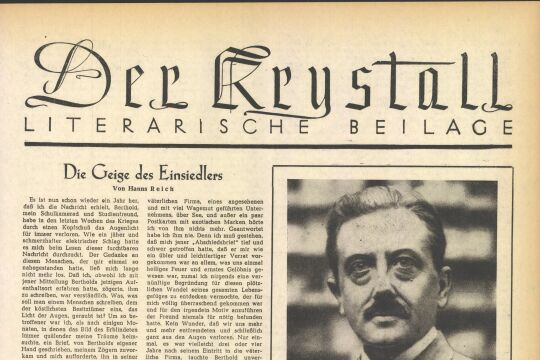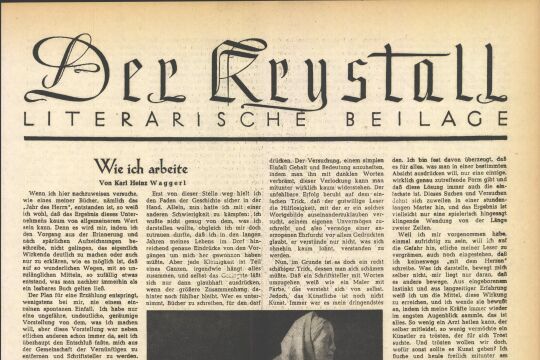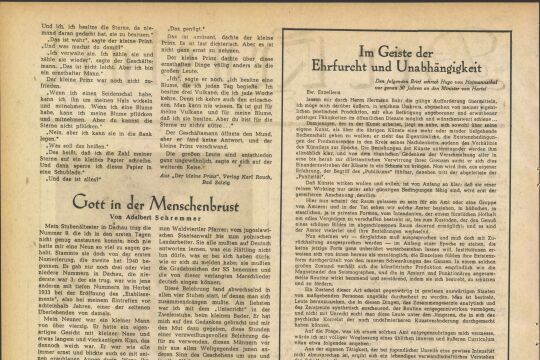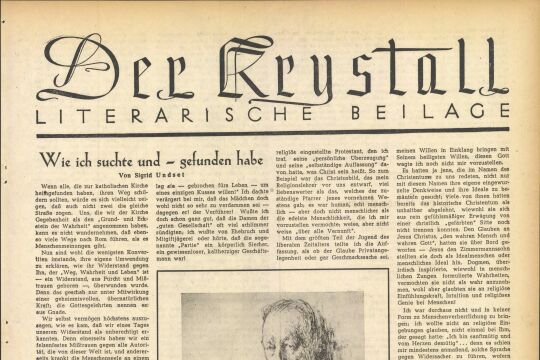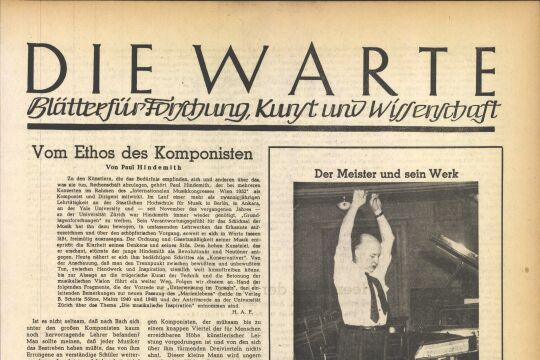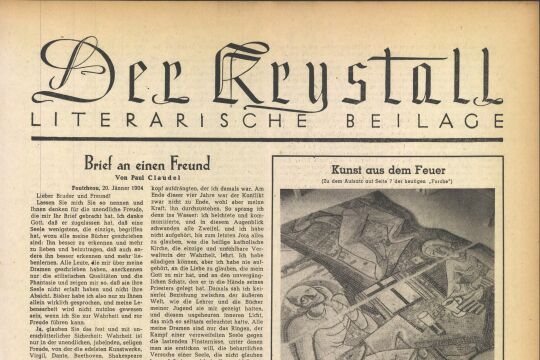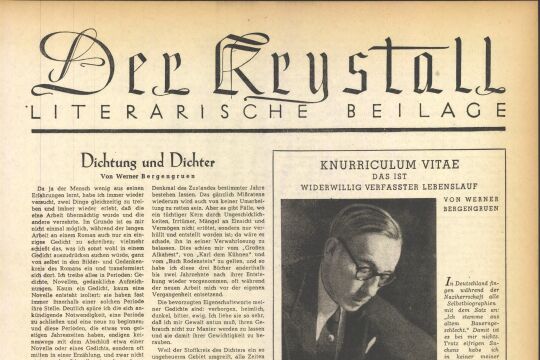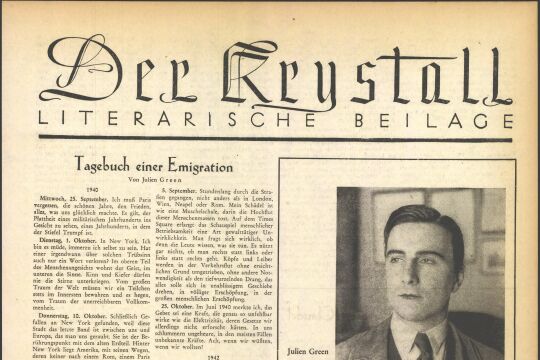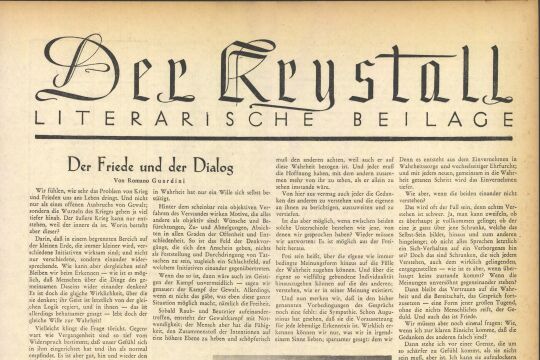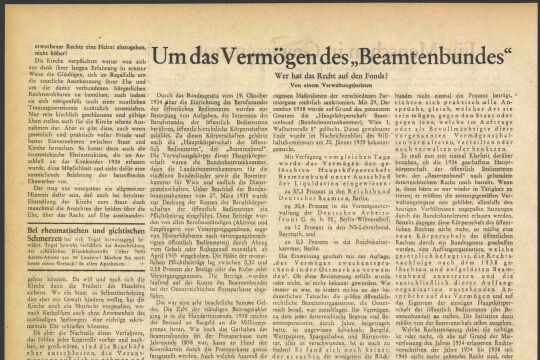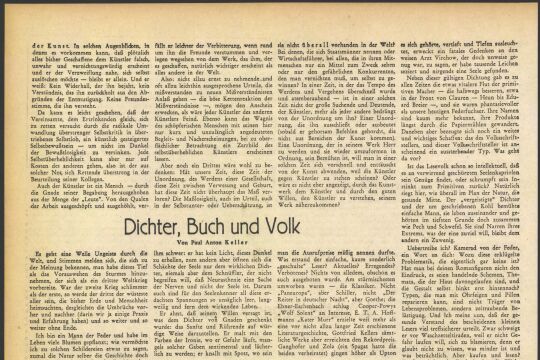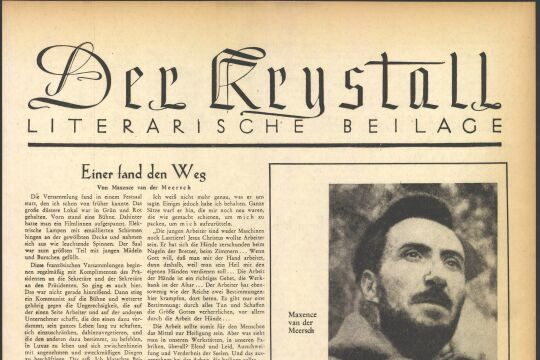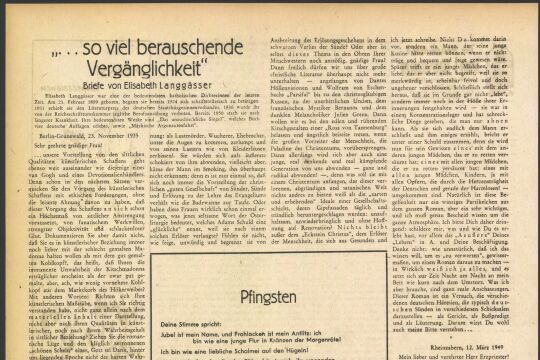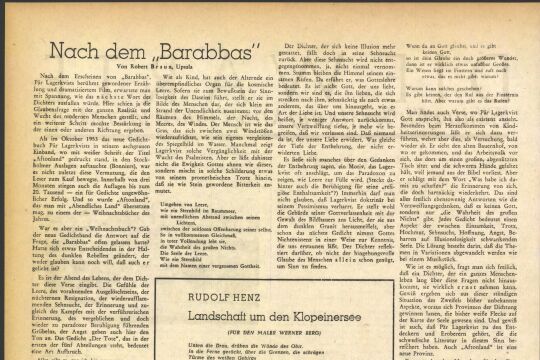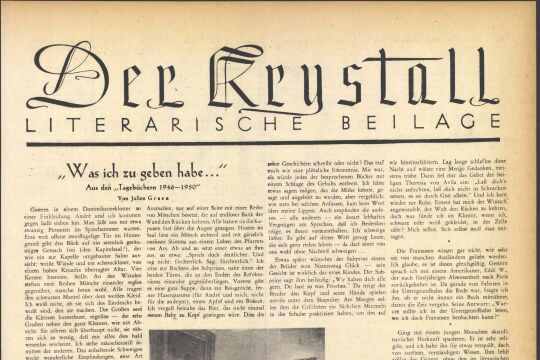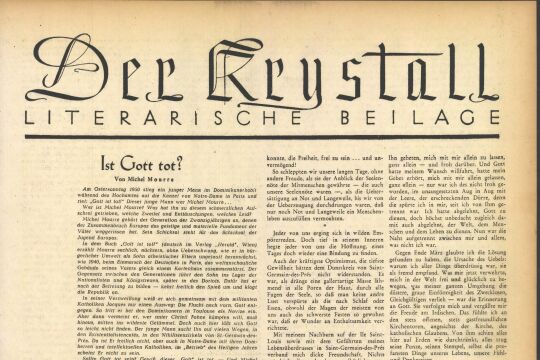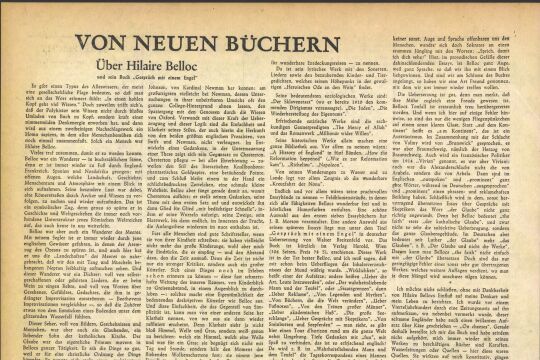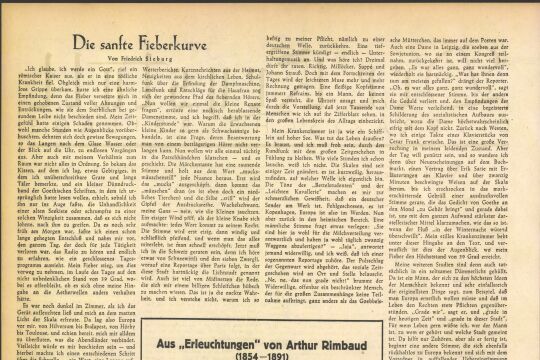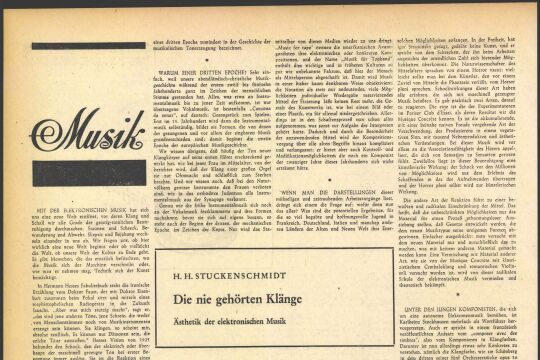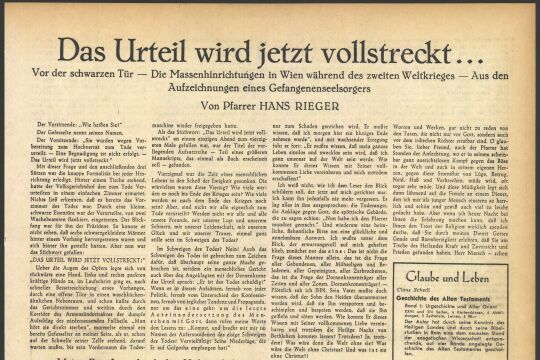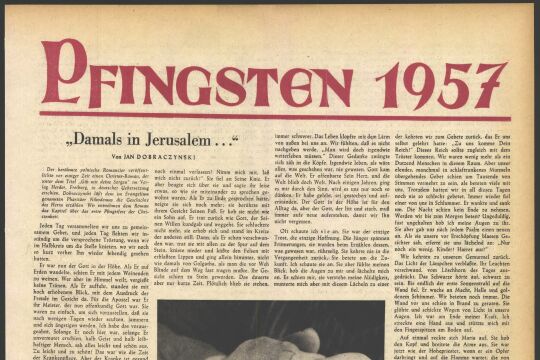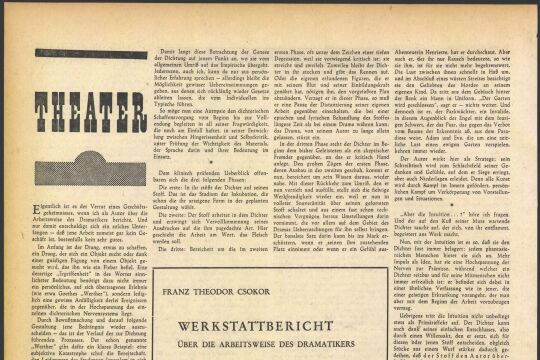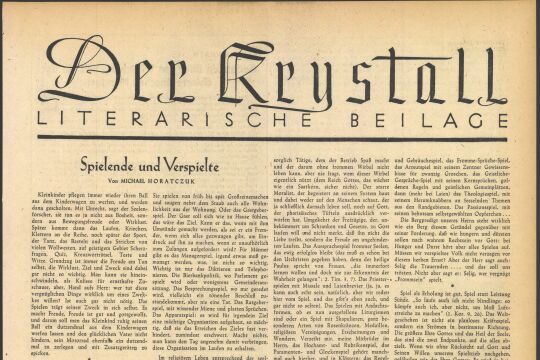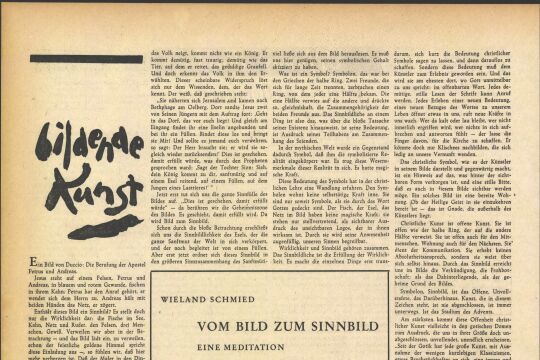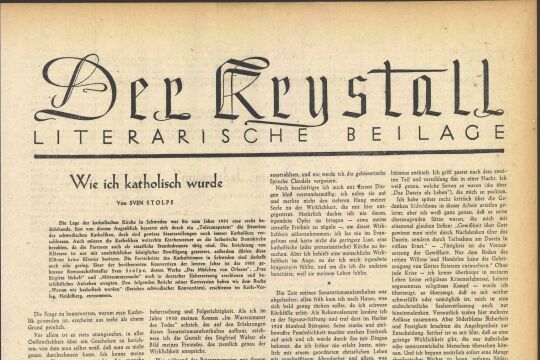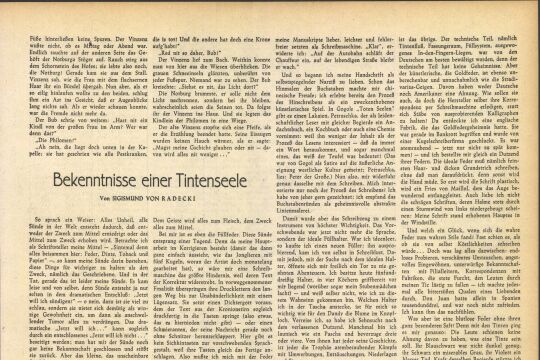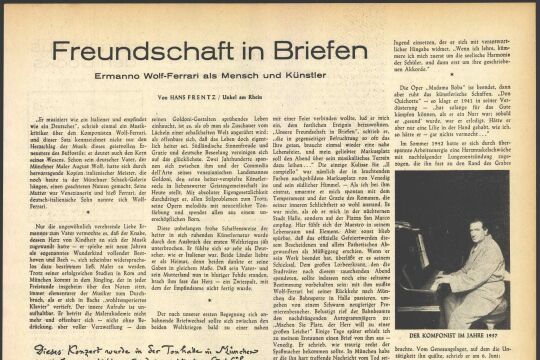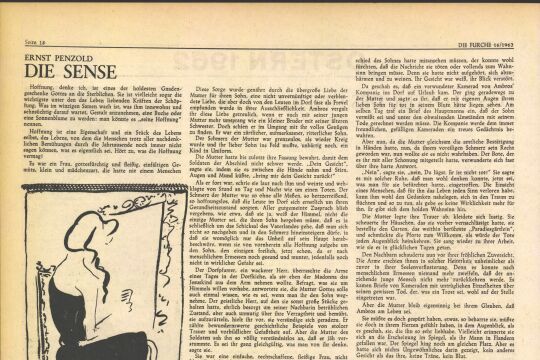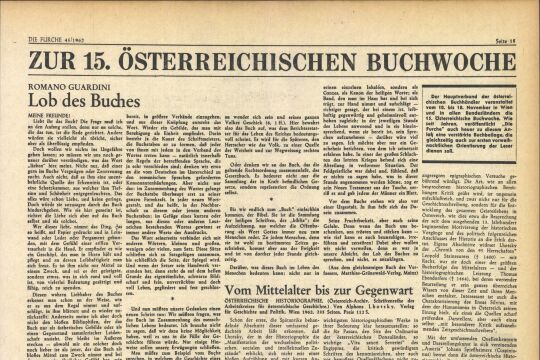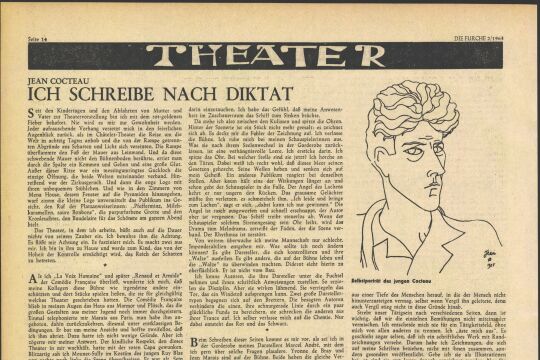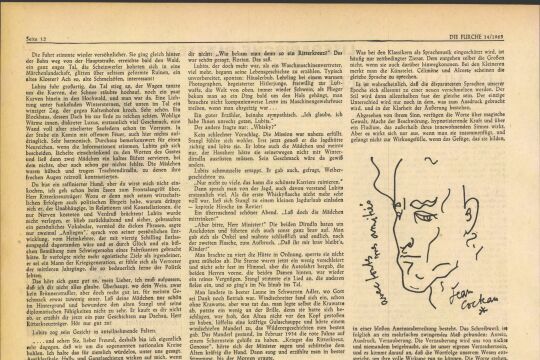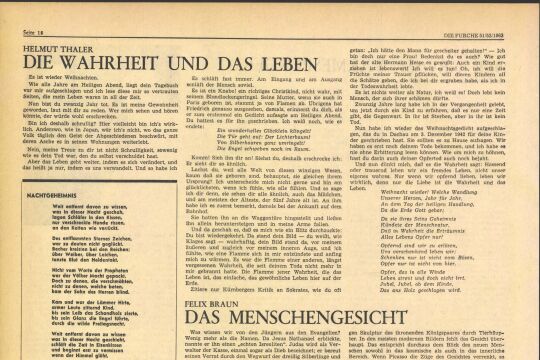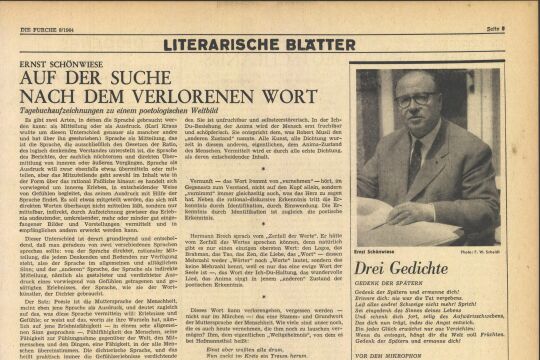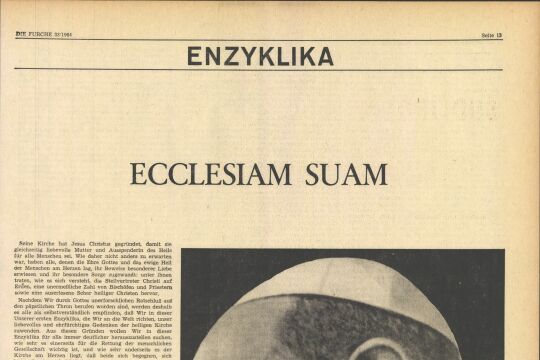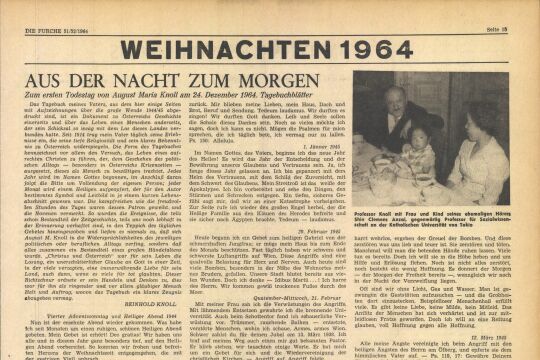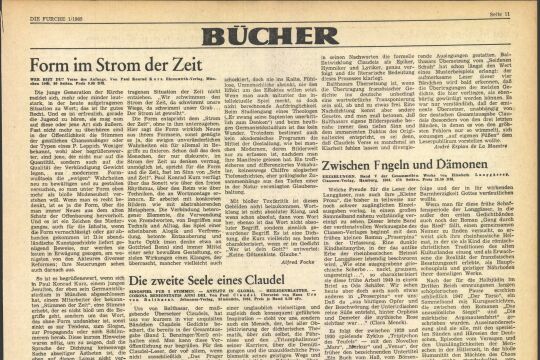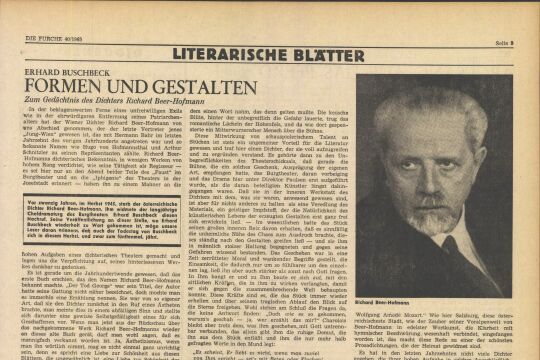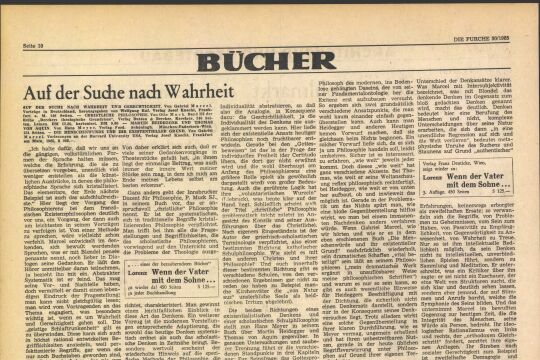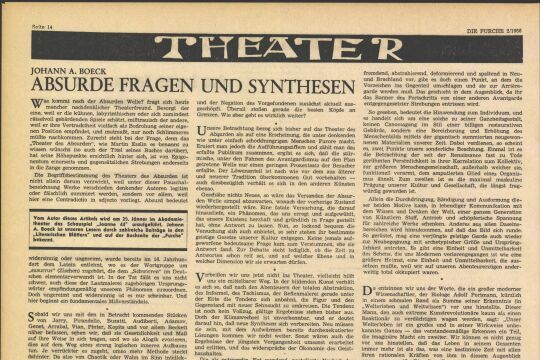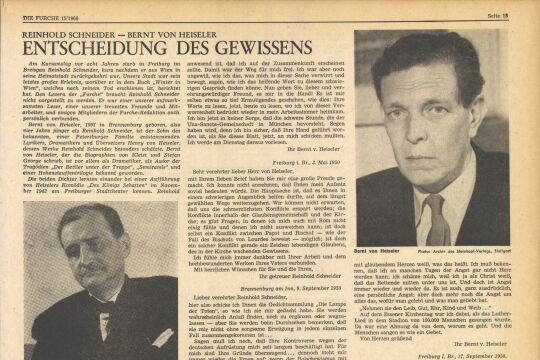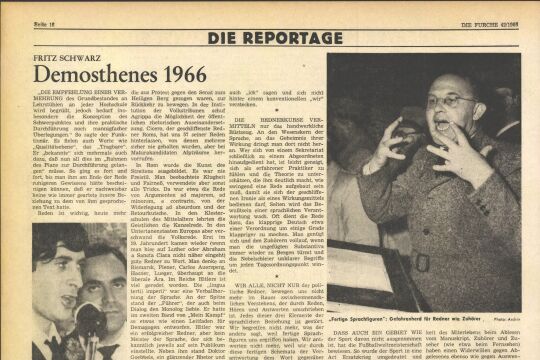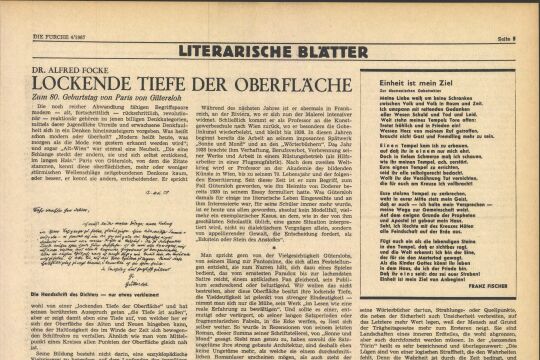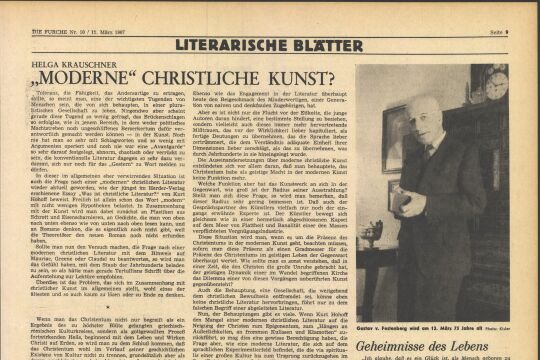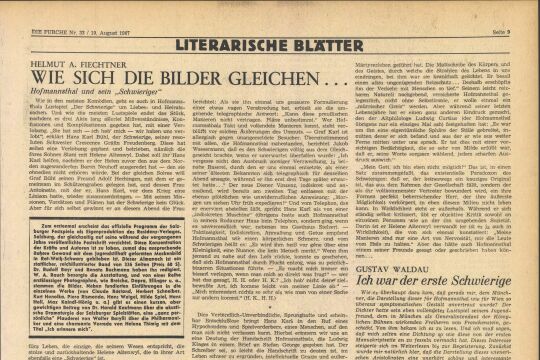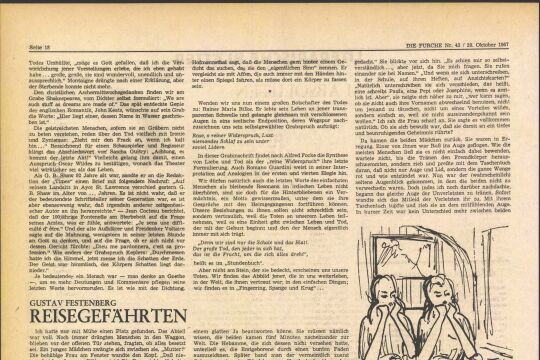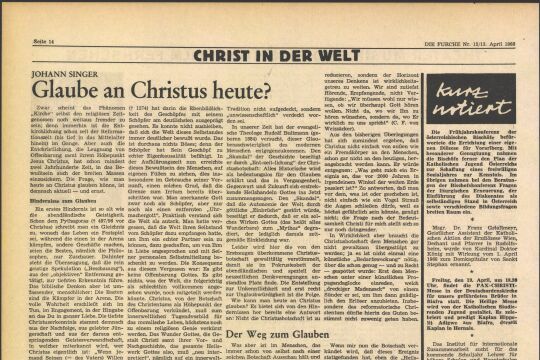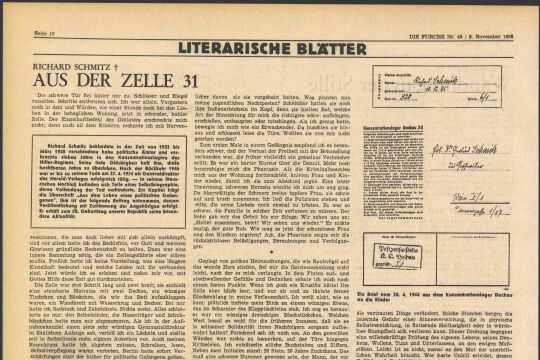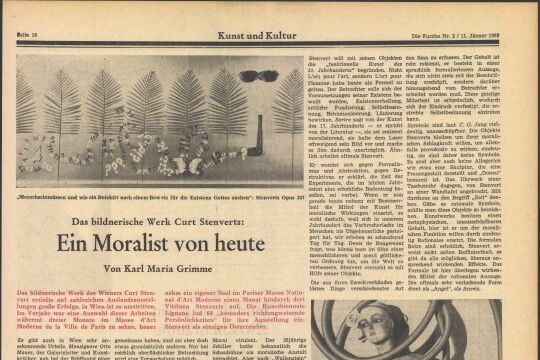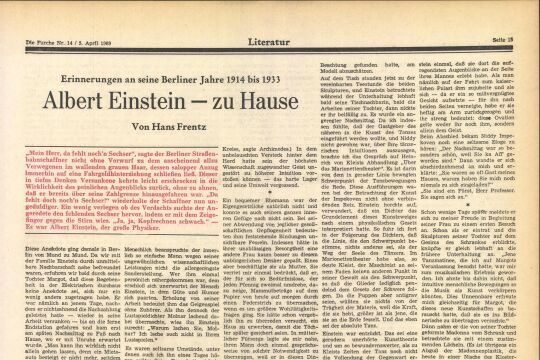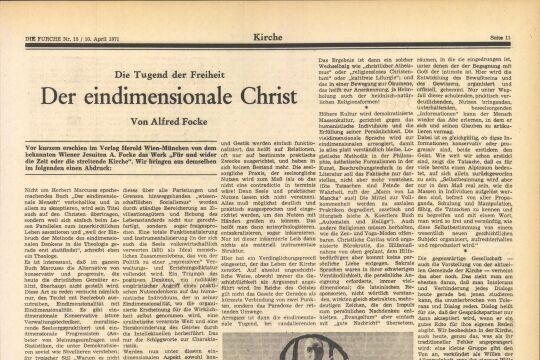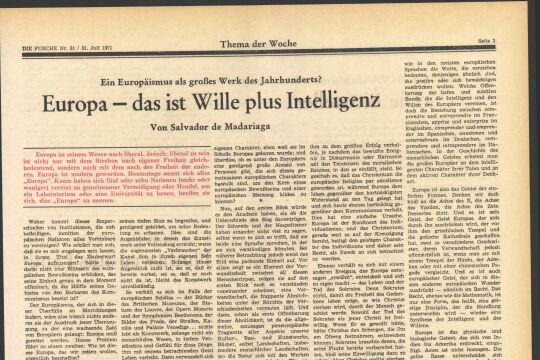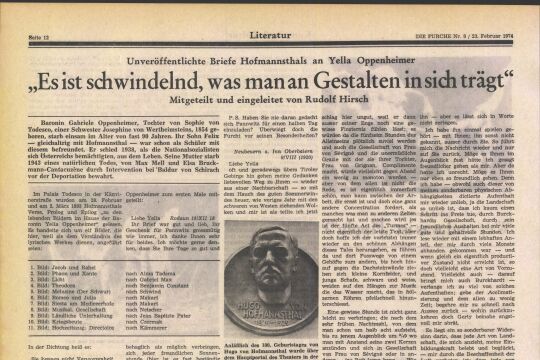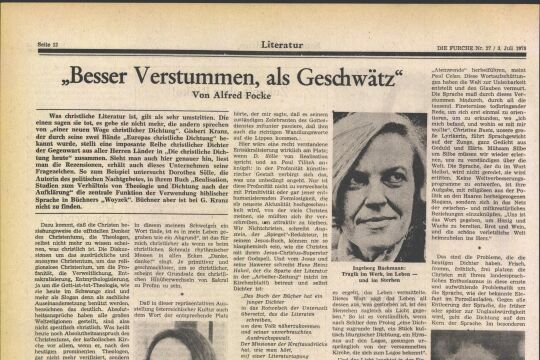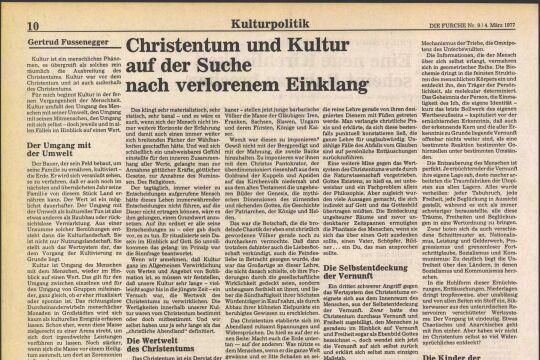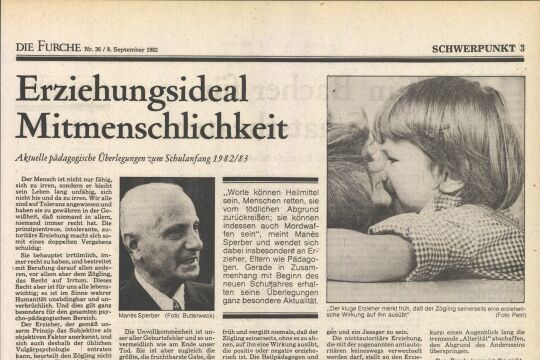Hört zu!
DISKURS
Hörvergessene Zeit
Ein Blick in die Kulturgeschichte zeigt: Es ist nicht das Sehen, sondern das Lauschen, mit dem wir die tiefgründige und existenzielle Dimension des Lebens berühren.
Ein Blick in die Kulturgeschichte zeigt: Es ist nicht das Sehen, sondern das Lauschen, mit dem wir die tiefgründige und existenzielle Dimension des Lebens berühren.
Der heiliggesprochene „Womanizer“, Lebemann, spätere Kirchenvater und Bischof von Hippo, Aurelius Augustinus, berichtet im achten Buch seiner „Bekenntnisse“, dass er in einer Art Erweckungserlebnis eine Stimme hörte, die sagte: „Tolle, lege – Nimm und lies.“ Als ihm klar wurde, dass das ein göttlicher Befehl war, öffnete er die Schriften des Apostel Paulus und in einer Art surrealistisch-objektivem Zufall entdeckten seine Augen folgende Stelle: „Nicht im Fressen und Saufen, nicht in Kammern und Unzucht“, sondern in Jesus Christus ist die Wahrheit zu finden. Augustinus las nicht weiter, denn „am Ende dieser Worte kam „das Licht des Friedens“ über sein Herz und „die Nacht des Zweifels entfloh.“
Rainer Maria Rilke wiederum soll 200 Fuß über den Fluten der Adria, auf Schloss Duino im Brausen eines Sturms „Wer, wenn ich schriee, hörte mich denn aus der Engel Ordnungen?“, den später ersten Satz seiner berühmten Duineser Elegien vernommen haben. Eines der frühesten Beispiele für Menschen, die eine wohlwollende innere Stimme zu hören vermochten, war Sokrates. Diese Stimme ewurde ihm zu einem freundlichen Begleiter.
Im Zeichen des Tinnitus
Das ist bemerkenswert, denn die westliche Philosophie laboriert am Primat des Visuellen: Die Gleichsetzung von Sehen und Erkennen hat sich in viele sprachliche Wendungen eingeschrieben. So spricht man etwa davon, dass etwas „einleuchtend“ oder „offensichtlich“ ist, einem ein Licht aufgeht, man im Dunkeln tappt. Im Wort „Evidenz“ und in der Forderung nach einer evidenzbasierten Medizin und Psychotherapie wird ebenfalls der sehende Weltbezug – lateinisch „videre“ heißt ja sehen – favorisiert. Aber tiefgründiger als das Sehen ist das Hören, das eine ethisch-existentielle Dimension des Lebens berührt. Menschen können aufeinander hören und im Zuhören ihre Interessen zum Ausgleich bringen – und der Einzelne kann sich fragen, wo er „hin-“ und was ihm „zugehört“. Letzteres geht aber nur dann, wenn man vor lauter Hektik und Getriebe überhaupt noch in der Lage ist, seine Lebensmelodie zu hören und nicht so viel um die Ohren hat, dass nur noch ein Pfeifen, besser bekannt als „Tinnitus“, zu vernehmen ist.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!