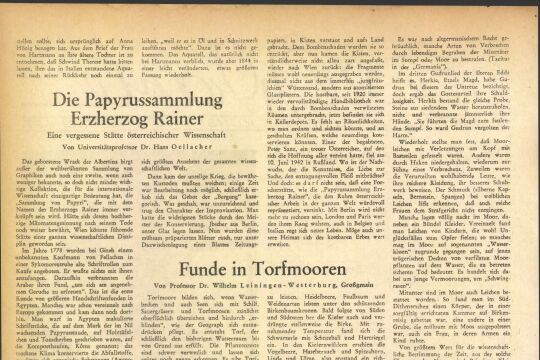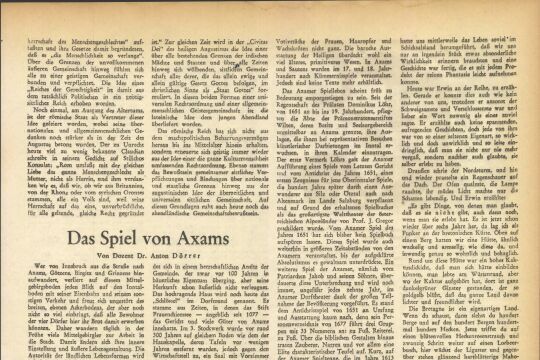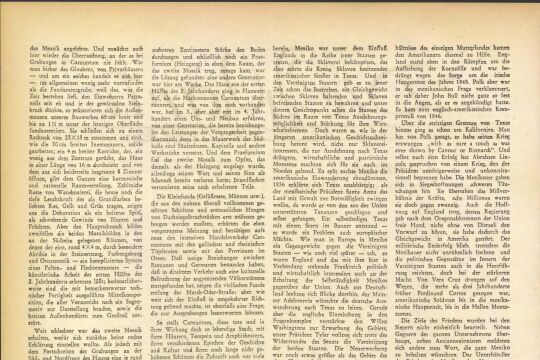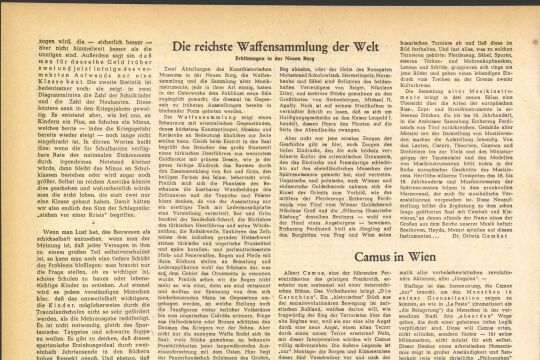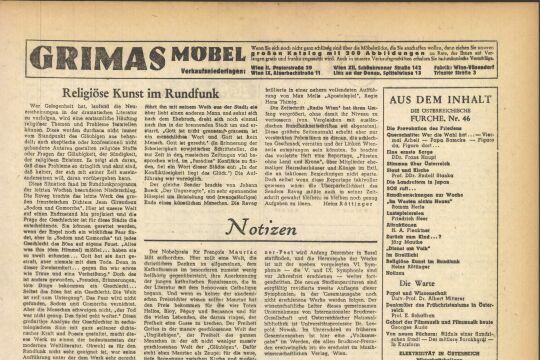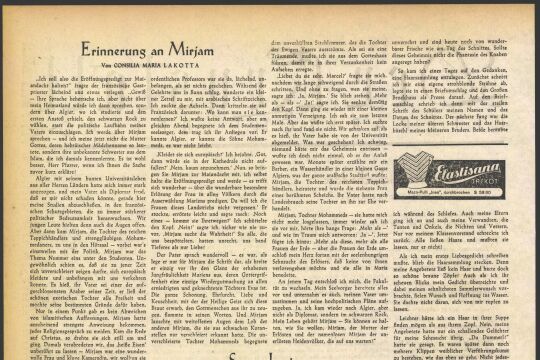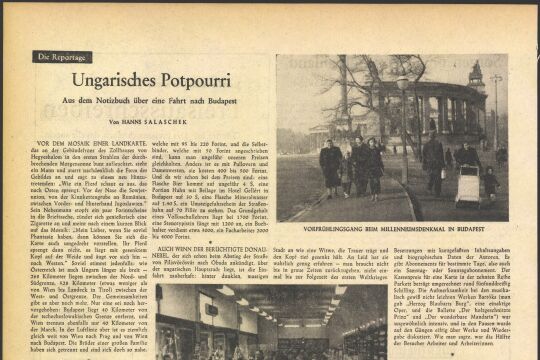Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
REI MONETARIAE
REI MONETARIAE steht in Großbuchstaben unter der Jahreszahl MDCCCXXXVII hoch oben auf dem Gebäude im dritten Wiener Gemeindebezirk, Am Heumarkt Nr. 1: „Für das Münzwesen.“ Zwischen 1835 und 1838 wurde das patrizisch anmutende Haus nach Plänen des Hofbaurates Paul Spranger erbaut, die Plastiken der Attika stammen aus den Jahren 1836/37 und sind von Joseph Klieber. Wenn je das Aeußere, das architektonische Gewand eine richtige Stimmung zu erzeugen vermag, dann geschah dies hier auf dem Grunde des alten Gold- und Silberdrahtzuggebäudes und des daran anschließenden, einst zum Wiener-Neustädter Kanal gehörigen Kohlenlagers. Ein Haus mit Maschinen, mit weitläufigen Arbeitssälen ist es', das wir unter sachkundiger Führung durchwandern, ein Haus, in dem keineswegs große Phantasie dazu gehört, sich das satte Glänzen der Edelmetallbarren und das berückende Funkeln der Münzen vorzustellen, die von hier aus in immerwährendem Strom ausgehen und in den Händen von Millionen ein Stück Lebensschicksal formen.
„ES IST EIN SCHÖNES DING“, das Gold, singt Rocco in Beethovens „Fidelio“. Mag sein, aber heute sind die Goldmünzen, die man auch im Hauptmünzamt ausprägt, die einfachen, vierfachen Dukaten, die Kronenstücke — herrliche Münzen, diese Stücke zu 100 Kronen mit der kaiserlichen Losung „Viribus unitis“ als Randverzierung —, alle diese Münzen sind keine gesetzlichen Zahlungsmittel mehr. Darum gingen wir geradewegs dorthin, wo man die Zehnschillingstücke herstellt. Zunächst wird das Edelmetall, quaderartige Blöcke, die wie Kuchenstollen aussehen, in einem elektrisch betriebenen Schmelzofen mit einem Kupferzusatz bei Luftabschluß und mehrmaliger Probierung des Feingehalts unter Ueberwachung des Münzwardeins geschmolzen. Das ist der erste Arbeitsgang. Alle dreiviertel Stunden wird das rotglühende Metall mit Graphitschöpfern, die zwölf Kilogramm wiegen, in Kokillen (Eingüssen) zu Zainen, das sind schmale Platinen, gegossen. Dann kommt das Entgraten und Abschneiden in der Exzenterpresse. Im dritten Arbeitsvorgang werden die erkalteten Zaine zwischen Walzen so lange ausgewalzt, bis sie die Stärke haben, welche die zu erzeugende Münze besitzen soll. Zwischen den Walzvorgängen weiden die Zaine mehrfach bis zur Rotglut erhitzt, wodurch sie eine bräunlich-gelbe Oberfläche bekommen. Diese wirklich recht unscheinbaren Metallstreifen würde man, lägen sie in irgendeinem beliebigen Fabrikshof umher, schwerlich für das Ausgangsmaterial unserer Silbermünzen halten. Aus den Streifen nun werden durch mächtige Stanzen, bei deren Lärm es uns schwer fällt, eine Unterhaltung zu führen, Plättchen herausgestanzt. Der Rest, die siebigen Streifen mit
den vielen Löchern, wird handlich zusammengefaßt und gedrückt, kommt dann wieder zur Schmelze. Die Plättchen wandern in eine an eine Waschtrommel erinnernde Vorrichtung, wo sich freilich keine für Wäsche geeignete Flüssigkeit befindet, sondern verdünnte Schwefelsäure mit noch einem Zusatz, der sozusagen Fabriksgeheimnis ist. So erhalten die vorher noch so unscheinbaren Plättchen den verlockenden metalligen Schimmer. Der vom Stanzvorgang etwas scharfe Rand wird abpoliert, beschädigte Stücke werden ausgeschieden. Die Rolliermaschine macht den leicht erhabenen Rand. Und dann folgt das Prägen der Oberseite und der Linterseite zugleich. Natürlich werden die Münzen genau — innerhalb des zulässigen Spielraumes — auf ihr Gewicht geprüft. Das besorgt eine automatische Waage. Ein zauberhaftes Ding, diese Waage; man glaubt, Geisterhände seien hier unter der Glashaube tätig. Niemand denkt im Augenblick, da diese Zauberhände werken, an die Jahrhunderte Geschichte, die ihnen vorangingen.
DIE GESCHICHTE des österreichischen Münzwesens läßt sich weit zurückverfolgen.
Ende des 12. Jahrhunderts noch war übrigens die Kremser Münze maßgebend, die älteste Münzstätte der Babenberger. Sie war Landesmünze bis zur Errichtung der Wiener Münze zwischen den Jahren 1130 und 1190. Um 1190
kam Walther von der Vogelweide nach Wien. 1195 wird ein gewisser Schlom als Wiener Münzmeister genannt. Damals lief Krems und später Wien dem Regensburger Pfennig den Rang ab. Neben dem „Wiener Pfennig“ hatte noch der „Friesacher Pfennig“ in der Mitte des 12. Jahrhunderts als eigener Münztypus Bedeu-
tung. Er führte sein Rohmaterial auf die Zeltschacher Gruben zurück, wo man Silber schürfte. Sie gehörten den Erzbischöfen von Salzburg und Gurk. Zwei gute Friesacher Pfennige waren gleich vier ungarischen und einem Kremser Pfennig. Zum ersten Male genannt werden die Wiener Pfennige 1203 in den Reiserechnungen des Bischofs Wolfger von Passau. In diese Zeit fällt die Gründung der Wiener Münzerhaus-Genossenschaft. „Am Hof“ war die Münze untergebracht, eine Urkunde Leopold des Glorreichen erwähnt sie. In den folgenden Jahren mußte sie mehrfach den Standort wechseln. Im ] 7. Jahrhundert befand sie sich im „Alten Posthaus“ in der Wollzeile. Im Jahre 1753, nach dem Tode des Prinzen Eugen, bezog die Münze dessen Palais in der Himmelpfortgasse. Der jetzig Sitz des Finanzniinisteriums hat also Tradition wie kaum ein anderes Bundesministerium. Von der Himmelpfortgasse übersiedelte die Münze in den jetzigen Bau.
INFLATION hat es in alter Zeit, freilich unter anderem Namen, auch schon gegeben. Der Wiener Pfennig hatte, als er durch die Münzer, die Genossenschaft von 48 reichen Bürgern und Goldschmieden, gegründet wurde, einen Feingehalt von einem Gramm Silber. Als Wertvergleich: das Lösegeld für Richard Löwenherz betrug 20.000 Mark in Silber, was 4677 Kilogramm Feinsilber entsprach. Bei Handgreiflichkeiten waren — sofern der Geohrfeigte ein Diener war (das kam am billigsten) — 60 Pfennig Buße zu zahlen. 1306 sank der Silberwert der Pfennige von neun auf sieben, in weiteren neunzig Jahren (damals ging es mit einer Inflation langsamer als in der modernen Zeit) auf fünf Silberheller. 1459 — in ganz Wien gab es elf Aerzte — klagte der Wiener Stadtrat, daß zwölf Pfund Pfennige nur einen Goldgulden wert seien, und ein Mut (ein Mut gleich 30 Metzen zu 46 Kilogramm) Weizen 32 Goldgulden koste. Diese fast nur noch aus Kupfer
bestehenden Pfennige hießen „Schinderlinge“. 240 von ihnen enthielten nur noch 2,88 Gramm Silber.
*
DAS HAUPTMÜNZAMT für die im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder hatte die Aufgabe, die jeweils gültigen Münzen auszuprägen. Daneben nahm aber die Ausmünzung der für besondere Zwecke dienenden Münzen
, einen breiten Raum ein. Von den Dukaten war schon die Rede. Heute werden sie zumeist für Schmuckstücke verarbeitet — von besonders Vorsichtigen allerdings als „wertbeständig“ gehortet (was, nebenbei gesagt, auch mit den jetzt gültigen Münzen zu 10 und 25 Schilling geschieht, die interessanterweise etwa vor Weihnachten in größerer Menge ans Tageslicht kommen). Die Ein- und Vierfachdukaten dürfen gemäß gesetzlicher Ermächtigung seit 1950 wieder ausgeprägt werden und finden regen Absatz auch im Auslande. Dort hat — wie ja viele wissen — der Mariatheresientaler geradezu Epoche gemacht. Ein Stück halten wir jetzt in der Hand. Es trägt das Bildnis der großen Kaiserin mit der Umschrift R.IMP.HU.BO.REG. M. IHERESIA A. D., auf: 'der Rückseite SSM eine Umschrift, das Wappen des iReiches'rRf die Jahreszahl 1780. Dieser seit 1751 ausgeprägte Taler erreichte eine Gesamtausprägungs-ziffer von rund 320 Millionen Stück. Er wurde zum größten Teil in die Levante geliefert. 1935 beschränkte freilich der mit Italien abgeschlossene Vertrag das österreichische Kontingent auf
. 10.000 Stück. Außer Wien prägten den Taler nicht bloß Rom, sondern auch London, Paris und Brüssel, während des Krieges nahm zudem 1940 Bombay die Prägung auf. Nach dem Kriege hob Abessinien die Gültigkeit auf (Demonetisie-rung). Abessinien war ein Hauptabsatzgebiet. In Jemen, Südarabien und Ostafrika läuft er aber noch, obzwar kein gesetzliches Zahlungsmittel, hochgeschätzt unter dem Namen „Rial-abutair“ (Vogeltaler).
DIE SÄCKCHEN mit ihren, den Münzsorten entsprechenden farbigen Streifen, die sich auch auf den Anhängezetteln finden, warten in dem Saal, wo wir zuletzt sind, auf die Beförderung zur Nationalbank. Das Mädchen vor uns drückt gerade die Plombe auf1 dem Verschluß zu. Rechts von ihr rattert die Zählmaschine. Wer nun Lust hat, kann einmal in seinem Leben „ins volle“ greifen. Aber merkwürdig: die lange Zeit des Aufenthalts in diesen vielen Räumen hat das Gefühl für den Wert, für die magische Gewalt der klingenden Münze ganz zum Verschwinden gebracht. Noch einige Fragen an unseren immer auskunftsbereiten Geleiterl Wird man dem jetzigen Schilling eine andere, vielleicht gelbliche Farbe geben, um ihn von den Münzen zu zehn Schilling zu unterscheiden? Ja, Erwägungen darüber sind im Gange. Wird die kleinste Scheidemünze das Fünfgroschenstück werden? Vorläufig jedenfalls nicht. Denn was heute mit Preisen zu zwei Groschen auskalkuliert ist, würde nicht verbilligt, sondern „aufgerundet“ werden. Bekommen wir ein neues Bild auf den Münzen zu 25 Schilling? Das wird als wahrscheinlich bezeichnet. Alle diese Dinge sind ja gesetzlicher Regelung durch den Nationalrat vorbehalten. Für die „Bundestheatermünzen“, die zu 1,5 Millionen ausgeprägt wurden, bezahlen Liebhaber heute bereits ein „Aufgeld“. Von den „Mozart“-und „Mariazell“-Stücken zu 25 Schilling wurden je 5 Millionen geprägt. Die Ausgabe ist abgeschlossen. Langsam gehen wir über den Innenhof. Dort steht unbeachtet ein Volkswagen. Drei Männer warten daneben. Niemand würde glauben, daß es ein Goldtransport ist. Alles ist hier mehr, als es scheint. Auch wenn es noch so hell scheint.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!