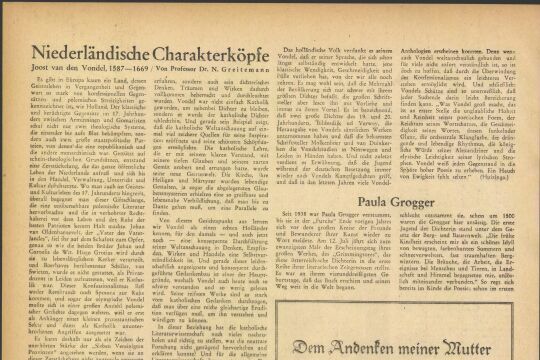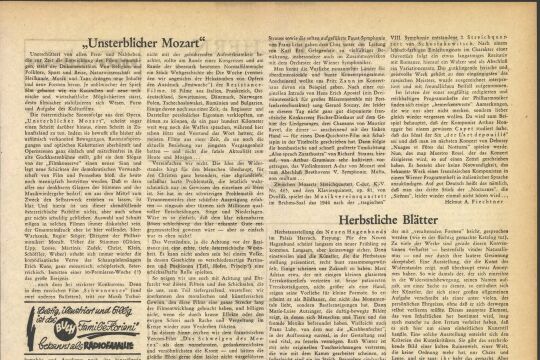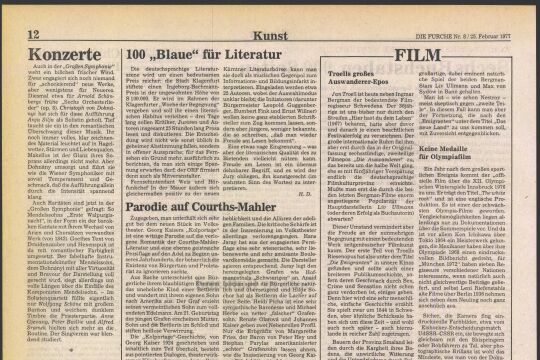Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Fehlstart
Bei allem Wohlwollen, das man heute jungen Filmtalenten entgegen- zubringen gewillt ist, muß man sich dennoch fragen, wofür der Spielfilm „Der Start“ des jungen Polen Jerzy Skolimowski bei der letzten Berlinale den Goldenen Bären erhalten hat. Eine Handlung durfte man sich bei einem Film dieses Genres ja kaum noch erwarten, bestenfalls noch ein mehr oder weniger zusammenhängendes Konglomerat von Assoziationen, Aphorismen und — Plattitüden. Der Film erzählt von der krankhaften Autoleidenschaft eines jungen Friseurs, der davon träumt, bei einem großen Rennen mitzumachen, dem aber dazu leider noch das entsprechende Auto fehlt. Skolimowski hat vor allem eine große Vorliebe für das Absurde, wie sich’s eben für einen Jungfilmer gehört. Wenn er einmal einen guten Einfall hat, dann hängt er sich daran und walzt den Gag so lange aus, bis selbst der geduldigste Zuschauer zu gähnen beginnt. Ging es dem Regisseur vielleicht darum, das Auto als Symbol für alle versteckten und verbotenen Sehnsüchte unseres chromblitzenden Zeitalters hinzustellen? Man glaubt es fast, wenn man sieht, wie ausführlich er die Besucher des Brüsseler Autosalons ins Bild bringt, wobei der Kameramann Willy Kurant seinem Regisseur bei dessen verspielten Exkursionen ins Irreale treue Gefolgschaft leistet. Während Skolimowski hier also einerseits beachtliche Ansätze von zeit- und sozialkritischer Treffsicherheit offenbart, verliert er sich anderseits zu sehr in Schnörkeln von Bild und Handlung und hinterläßt schließlich — was allerdings seine Absicht gewesen sein dürfte und auch in der nihilistischen Schlußeinstellung zum Ausdruck kommt — das Gefühl einer absoluten Leere. Unbedingt erwähnen muß man noch die Leistungen der beiden Hauptdarsteller Jean-Pierre Leaud und Catherine Duport. Besonders Leaud ist ein junger Darsteller voll überschäumendem Temperament und feinnerviger Physiognomie, dem man die ganzen Verrücktheiten dieses Autofetischisten eventuell noch abkaufen könnte.
Nach einem amerikanischen Bestseller und Erfolgsmusical entstand eine der amüsantesten und zugleich geistreichsten Persiflagen, die seit langem auf der Kinoleinwand zu sehen waren, David Swifts „Wie man Erfolg hat, ohne sich besonders anzustrengen“. Der Film wurde nach einer Broadway-Inszenierung gedreht und beinhaltet natürlich stellenweise noch gewisse theatralische Übertreibungen, ist aber gleichzeitig als Film so bis an die Grenze des Möglichen überdreht, so daß das eigentlich kaum noch stört. Das Drehbuch des Produzenten und Regisseurs David Swift enthält einen durchwegs pointenreichen Dialog, gespielt wird hervorragend. Robert Morse vereint als Darsteller des „erfolgreichen“ J. Pierpont Finch den schauspielerischen Ernst eines Buster Keaton mit dem mimischen Ausdruck eines Jerry Lewis, ohne jedoch jemals in dessen Klamaukeskapaden zu verfallen. Ein ganz ausgezeichneter junger Charakterkomiker, dem man unschwer eine große Karriere prophezeien darf. Darüber hinaus ist dieses amerikanische Lustspiel — abgesehen von der gewohnten technischen und darstellerischen Perfektion — durchgehend schwungvoll inszeniert, bietet Gags und Pointen am laufenden Band und eine augenzwinkernde Selbstpersiflage, die in jedem Punkt ins Schwarze trifft.
Franz Anitel, der sich neuerdings in aller Bescheidenheit „Legrand“, „der Große“, nennt, gibt gar nicht vor, Seriöses schaffen zu wollen, er hält es mit der „Unterhaltung“ und seine „Susanne — Die Wirtin von der Lahn“ schwimmt ebenso auf der „mutigen“ Sexwelle und schreckt auch vor Peinlichkeiten keineswegs zurück. Moser und Hörbiger, einst Antels Hauptdarsteller in vielen Filmen, machten aus schwachen Büchern und trotz farbloser Regie aus eigener Kraft manchmal sogar ansprechende Unterhaltung. Derzeit ist aber nicht menschliches Gemüt und herzliche Komlik gefragt, sondern Sex offenbar das große Geschäft.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!