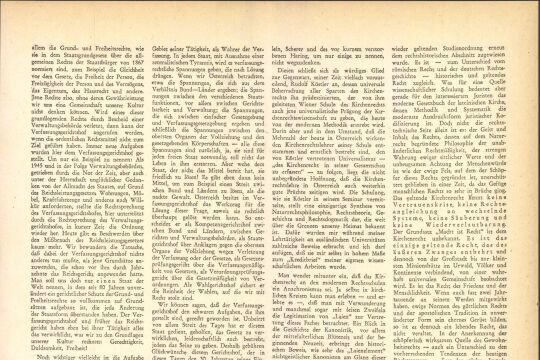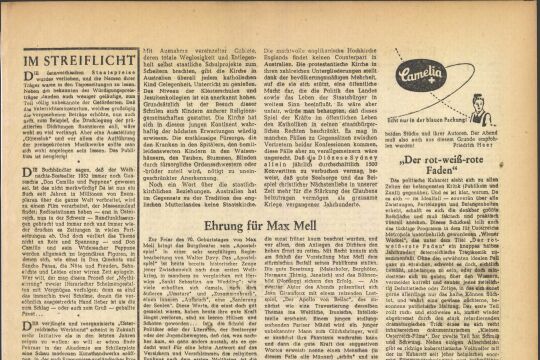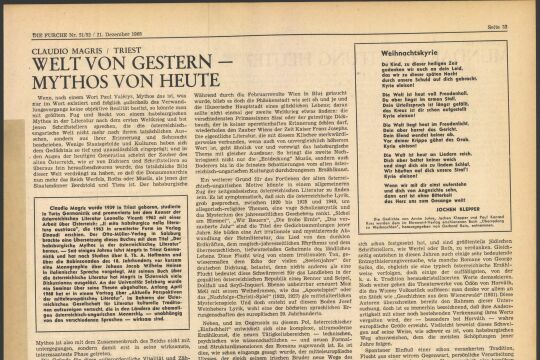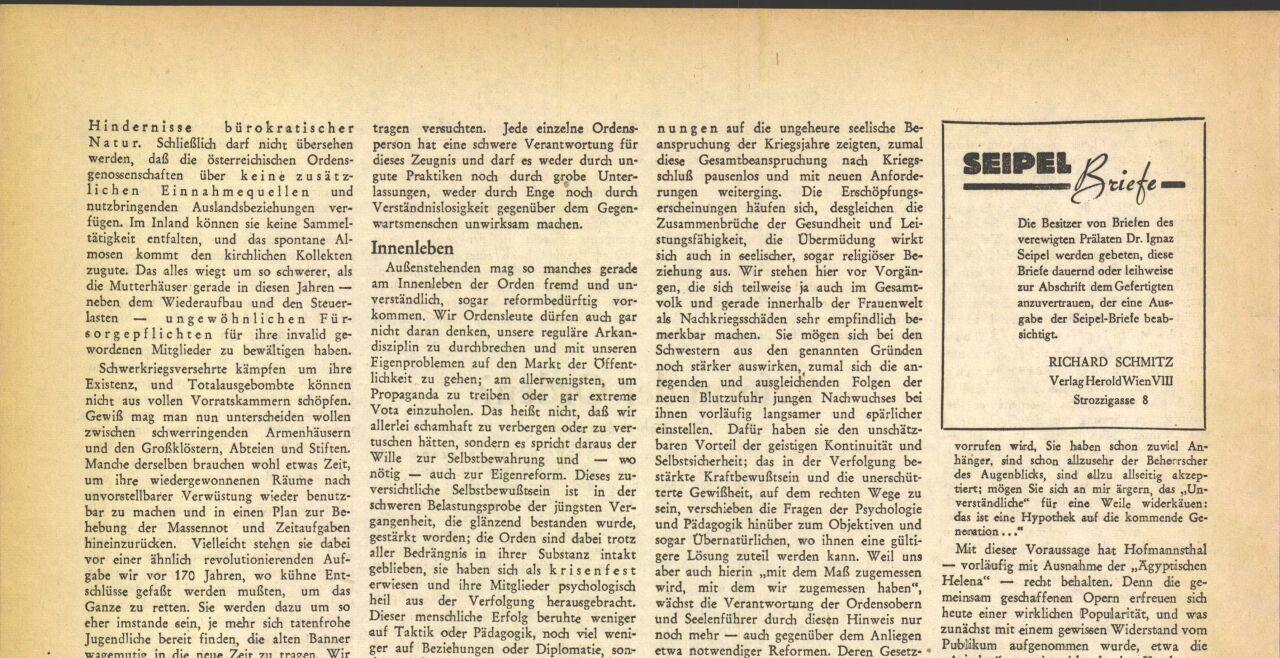
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Leichtes Spiel von gestern und vorgestern
Bruno Schupplers Komödie „Junger Herr von vierzig Jahren“ — letzte Sommerpremiere des Akademietheaters — spielt in einer Welt, die es nicht gibt, nie gab und die hierzulande doch eine psychologische Realität ist: in jenem Traum-Österreich, das ein Teil der jüngeren Generation nach den Jugenderinnerungen ihrer Eltern und nach Schnitzler, Bahr und Hofmannsthal gebildet hat. Elemente echten Rück- erinnerns und Einfühlens, eine durch zwei Weltkriege doch nicht ganz unterbrochene seelisch-geistige, in der Atmosphäre wie im Blut liegende Überlieferung, dazwischen die unausrottbaren Schablonen’ der Operetten- und Heurigenfilme, flechten ein seltsames Trapez, auf dem die Komödie federnd auf- und abschnellt — keinen festen Grund, den doch auch die übermütigste Posse (siehe unten Shaw und Nestroy) braucht. Der Held, eine im Grunde sehr echte österreichische Gestalt: der etwas verspielte, nicht mehr ganz junge, mit dem Älterwerden kokettierende Herr mit dem leicht verschlampten Gefühlsleben, der „liebe Kerl“, den alle gern haben und dem über dieser im Jünglingsalter angenommenen Charmeurrolle allmählich das wirkliche Leben zwischen den Fingern verrinnt. Eine lebenswahre, fast ein bisserl tragische Gestalt, der in der Fülle der Einfälle und komischen Situationen, im Wirbel der echten und unechten, doch fast immer bühnenwirksamen Figuren nicht genug Spiel- und Lebensraum bleibt. Gesamteindruck: kein Gestern und kein Heute, sondern ein Heute, das Gestern spielt und dabei doch nicht aus seiner Haut kann. Das Milieu, die Atmosphäre jener versunkenen Welt am echtesten in den hübschen Kostümen und den sehr stimmungsvollen Bühnenbildern.
„Man kann nie wissen“ von Shaw in der „Insel“ — ein altes Stück, vor Jahren im Akademietheater, fest in der Welt um die Jahrhundertwende wurzelnd. Mit gewissen Auswüchsen des Frauenrechtlertums wird zugleich die ganze übersteigerte Erwartung des kommenden „zwanzigsten’ Jahrhunderts“, werden die Utopien einer extrem- „modernen“ Familie und Kindererziehung verulkt — ein Stück bester Shawscher Selbstpersiflage, wie jeder echte Bühnenhumor eben ein Stück Selbstironie enthalten muß. Die „Insel“ hat hier, nach den weniger glücklichen Versuchen von „Androklus“ und „Mensch und Übermensch“, bei ihrem Lieblingsautor Shaw einen ausgesprochen glücklichen Griff getan und eine geschlossene, gepflegte Aufführung zustande gebracht, gleichwertig dem seinerzeitigen Erfolg der „Helden“.
Die lebendigste, jüngste, frischeste Premiere der Woche das älteste Stück, Nestroys „Mädl aus der Vorstadt“ im „Studio der Hochschulen“. Der Staubwedel des Stubenmädchens Nanette (der die Regie und die Gesangstexte des auch in der Rolle des „Gigl“ ausgezeichneten Michael Kehlmann symbolisiert) hat nur ganz leise hintupfen müssen und schon erstand das Stück wieder in seiner ganzen Jugendfrische. Die sehr beherzigenswerte Lehre: ein Stück, das einst selbst fest auf dem Boden seiner Welt stand, kann durch kongeniale, theaterbegeisterte Jugend auch nach einem Jahrhundert wieder zu neuem Leben erweckt werden, auch wenn der soziale Gegensatz von Stadt und Vorstadt heute nicht mehr „aktuell“ ist. Aktuell sind dafür die Couplets, und das ist unumstößliche Tradition der Wiener Volksbühne. Man darf es daher den jungen Theaterleuten auch nicht allzusehr ankreiden, wenn sie dabei einmal ausrutschen und — um das hübscheste Couplet des Abends zu variieren — tagespolitisch etwas „die Gon- tenance verlieren“. Schade, daß dieses wirklich echte Volkstheater in der Kolingasse — am Boden des alten Glacis, zwischen „Stadt“ und „Vorstadt“, der Öffentlichkeit zu wenig bekannt wird. Wie wäre es mit einem Ausflug des „Mädls au9 der Vorstadt“ hinaus in die Vorstadt, in die Vororte und darüber noch hinaus auf die Provinzbühnen?
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!